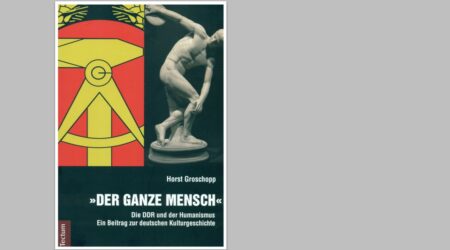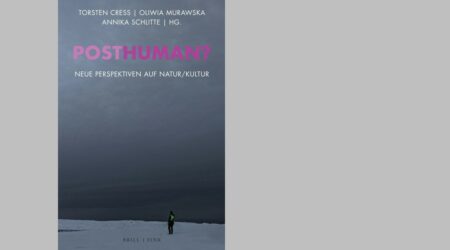Wer gehört zur Familie? Humanismus heißt, für die Vielfalt der Lebensweisen streiten!
Wofür lohnt es sich zu leben? Mit wem sind oder werden wir glücklich? Wer gibt Halt und Unterstützung, auch in schwierigen Situationen? Wo findet Liebe ihren Ort? Wo Verantwortung und Vertrauen? Mit wem möchte ich mein Leben teilen, in guten wie in schlechten Tagen? Und bis wann? Und auf welche Weise? – Auf existenzielle Fragen wie diese gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Antworten. Bewusst oder unbewusst werden sich wohl die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens immer wieder mit solchen Fragen auseinandersetzen, vielleicht auch herumschlagen. Manche mögen sich dabei an klassischen Rollenbildern und Erwartungen orientieren und darin eine Erfüllung finden, andere gerade mit jenen gesellschaftlichen Normen hadern und in der bewussten Abweichung von der vermeintlichen Norm ein Zuhause finden. Dass sich im Zuge gesellschaftlicher Liberalisierung in den vergangenen Jahrzehnten neue Lebensmodelle etablieren konnten, hat jedenfalls zu einer Ausdifferenzierung der Familienauffassung und der Lebensmodelle geführt. Beim Stichwort „Familie“ sind heute zahlreiche Assoziationen selbstverständlich und erlaubt: Es gibt Kleinfamilien und Großfamilien, aber genauso Einelternfamilien, es gibt Patchworkfamilien und Regenbogenfamilien, sogar Wahlfamilien und Verantwortungsgemeinschaften sowie Wohn- als Lebensgemeinschaften sind möglich. Nicht alle haben den gleichen rechtlichen Status, zumindest aber wird über ihren Status und eine rechtliche Gleichstellung politisch diskutiert. Einige dieser Familienmodelle hätten bis vor wenigen Jahrzehnten nicht als Familie gegolten, manche, wie die Regenbogenfamilie, waren sogar strafrechtlich sanktioniert, erinnert sei hier an den furchtbaren § 175 StGB.
Ein konkretes Familien- und Lebensmodell als normal auszuweisen, hat oft den – mal gewünschten, mal unerwünschten − Nebeneffekt, andere Modelle als nicht oder weniger normal, gar als defizitär erscheinen zu lassen. Das verengt unnötig den Fokus, auch mit ganz praktischen Auswirkungen. Was nicht der Norm entspricht, fällt schnell durchs Raster. Für die Beratungspraxis von Sozialverbänden oder auch weltanschaulichen Organisationen könnte das bedeuten, dass sich Menschen nicht an solche Einrichtungen wenden, weil sie sich dort nicht willkommen fühlen. Oder schlimmer: diese Institutionen weisen Menschen auf der Suche nach Unterstützung ab, weil sie keine passenden Angebote für ihre Lebenssituation haben. Schwule Männer zum Beispiel, die ein Kind adoptieren oder ihre Verantwortungsgemeinschaft rechtlich regeln wollen, haben einen anderen Beratungsbedarf als ein heterosexuelles Paar. Dramatischer wirkt die Normierung durch gesellschaftliche Akteure jedoch auf individueller Ebene, denn sie schränkt auch den Möglichkeitsspielraum ein, den Menschen für ihr eigenes Leben und Zusammenleben in Betracht ziehen können. Wer nicht als „normal“ gilt, der oder die erfährt durch dieses gesellschaftliche Urteil eine Form der symbolischen Gewalt und erlebt nicht selten ein Gefühl des Scheiterns. Dies führt mitunter zu dramatischen Konsequenzen. In einer Studie der renommierten Columbia University (Hatzenbuehler 2011) berichten unfassbare 20 Prozent der homosexuellen US-Jugendlichen von einem Selbstmordversuch in den vergangenen 12 Monaten (der Vergleichswert bei heterosexuellen Jugendlichen lag bei 4 Prozent). Diesen Menschen mit dem Hinweis zu begegnen, sie sollen sich doch zur Milderung ihres Leids auf traditionelle Familienwerte besinnen, scheint nachgerade zynisch. Wenn der Anspruch des Humanismus ist, für die Interessen einer menschlichen Gesellschaft zu streiten, muss es dann nicht gerade sein Ziel sein, für die Anerkennung der Vielfalt menschlicher Lebensweisen zu kämpfen? Dass heute auch eine lesbische, kinderlos glückliche Liaison (vielleicht sogar mit mehr als zwei Personen) als gelungenes Familien- und Lebensmodell gelten darf, dass das gefeierte Paar des Schulabschlussballs auch einmal schwul sein kann, ohne dass irgendwer daran Anstoß nähme, dass auch eine ältere „alleinstehende“ Person in einer Wahlfamilie mit Freundinnen glücklich wird: all dies sind gesellschaftliche Fortschritte der jüngsten Vergangenheit, die das Leben heute humaner machen als noch vor wenigen Jahrzehnten.
Doch diese Fortschritte sind nicht unhintergehbar und unumkehrbar, das zeigen gesellschaftliche Entwicklungen weltweit. In Ungarn beschloss das Parlament im Jahr 2021 ein Gesetz, das die Darstellung und Thematisierung von Homosexualität gegenüber Minderjährigen unter Strafe stellt. Ein Kinderbuch, das ein Märchen von zwei schwulen Prinzen erzählt, darf damit nur noch – für Kinder nicht sichtbar – unter dem Ladentisch verkauft werden. Im US-Bundesstaat Florida wurde im Frühjahr 2022 ein Gesetz verabschiedet, das es Lehrkräften verbietet, mit Kindern über die Diversität von Geschlechtsidentitäten zu sprechen. Dass Menschen, die anders sind als die Mehrheit, keineswegs unnormal oder minderwertig sind, soll für junge Menschen also möglichst unerfahrbar bleiben. Die Familie mit Vater, Mutter und Kind(ern) gilt als einzig legitimes Rollenmodell, auf das hin sich alle zu orientieren haben. Wer anders ist, soll das doch bitte verschweigen oder besser noch: unterdrücken – mit fatalen individuellen Konsequenzen. Auch in Deutschland sind die Fortschritte gesellschaftlicher Liberalisierung mitnichten gesichert, auch hierzulande drohen gefährliche Rückschritte: So hat die AfD im Jahr 2018 einen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht, der die 2017 eingeführte Ehe für gleichgeschlechtliche Paare wieder abschaffen will. Damit eine solche Programmatik keine politische Mehrheit erlangt, bedarf es gesellschaftlichen Engagements auf allen Ebenen.
Gerade angesichts solch reaktionärer Bestrebungen sollte der Humanismus in der Tat Orientierung geben, wofür es sich zu kämpfen und zu streiten lohnt. Orientierung aber ist, für sich genommen, ein bloß formaler, sehr unterschiedlich deut- und füllbarer Begriff. Auch reaktionäre Ideologien bieten eine − sogar sehr stabile − Orientierung. Dagegen ist die Orientierung, die der Humanismus geben kann, eine inhaltlich bestimmte: eine Orientierung im kritischen Überprüfen und Hinterfragen, was den humanistischen Idealen wie Freiheit, Menschlichkeit, Solidarität und Vernunft entspricht. Eine Forderung des Humanismus muss entsprechend lauten, dass Menschen ein möglichst selbstbestimmtes Leben leben können. Überall, auf der ganzen Welt. Dieser Universalismus bedeutet aber gerade nicht, dass alle Menschen uniform dem gleichen Lebensmodell nacheifern sollen. Wie traurig, fad und langweilig wäre menschliches Leben, wenn alle das Gleiche täten. Universalismus bedeutet, wenn er nicht totalitär sein soll, notwendigerweise einen pluralen Universalismus, in dem kein exklusives (oder exkludierendes) Leitbild aufgezwungen wird. Im Gegenteil sind gesellschaftlich normierte Rollenerwartungen dort zu kritisieren, wo sie einen unmenschlichen Druck ausüben und die freie Entfaltung der Persönlichkeit verunmöglichen. Maßstab der Kritik muss Selbstbestimmung sein − im Wissen darum, dass dies ein Begriff mit zahlreichen Widersprüchen und Konfliktpotential ist, etwa wenn es um Solidarität und Verantwortung geht.
Apropos „Leitbild“: Es handelt sich dabei um eine recht junge Wortschöpfung, ein Modewort des späten 20. Jahrhunderts. Das Digitale Wörterbuch der Deutschen Sprache verzeichnet sein erstes, sehr sporadisches Vorkommen um 1900, regelrecht Konjunktur hat das Kompositum ab Ende der 1950er Jahre mit einem Höhepunkt um 1968, eine zweite Hochkonjunktur erlebt es um das Jahr 2000. Der Verdacht liegt nahe, dass Leitbilder immer dann heraufbeschworen werden, wenn vermeintliche Naturgesetze des menschlichen Lebens ins Wanken geraten. Haben seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die feministische Bewegung und die counter culture der 68er die tradierte Geschlechteraufteilung, das Modell der Hausfrauenehe und die Familienpolitik der Wirtschaftswunderjahre sukzessive infrage gestellt und den Frauen zunehmend einen gerechteren Platz in der Gesellschaft erkämpft, so ist die gesellschaftliche Anerkennung homosexueller, transidenter und queerer Menschen seit der Jahrtausendwende auf dem Vormarsch. Die Konjunkturen von Leitbild-Diskussionen wirken wie eine Verteidigung gegen solche Entwicklungen. Sie entsprechen jedenfalls kaum den Einstellungen in der deutschen Bevölkerung, wo bei Fragen der Diversität von Identitäten und Lebensentwürfen eine enorme Anerkennungsbereitschaft existiert (Mau, Lux und Gülzau 2020).
Unabhängig von dieser begriffsgeschichtlichen Auffälligkeit stellt sich die Frage, was der Mehrwert eines Leitbildes sein soll. „Leitbild“ klingt monolithisch: als gäbe es genau ein Muster, das allen zum erstrebenswerten Vorbild gereichen soll. Kann es nicht aber auch verschiedene Vorbilder mit gleicher Berechtigung nebeneinander geben? Und wären solche im Plural gedachten Vorbilder für humanistisches Engagement nicht das geeignetere Modell? Unbenommen erfüllen Vorbilder eine wichtige Funktion, gerade für Heranwachsende. Wenn aber eine tolerante Gesellschaft Sinn und Zweck humanistischer Pädagogik ist, wenn es also darum geht, zum selbstbestimmten Leben möglichst frei von religiöser oder ideologischer Bevormundung zu ermutigen, dann sollte nicht das allein auf biologische Reproduktion abzielende Familienmodell als Norm gepredigt werden. Zu fragen wäre eher, was wünschens- und erstrebenswerte Elemente gelungener Bindungen zwischen Menschen sind. Und welche sozialen, politischen und ökonomischen Bedingungen erfüllt sein müssen, um solche Elemente zu befördern. Alle Menschen sollten ein Recht haben, irgendwo zuhause zu sein, einen Ort und ein menschliches Umfeld zu haben, an und in dem sie sich wohl fühlen und frei entfalten können. Ein solches Zuhause bedeutet auch eine private Sphäre, in die nicht jeder einfach eingreifen darf, die sich also gerade in der Abgrenzung zur Öffentlichkeit und ihren politischen Kampffeldern konstituiert. Für diese Privatsphäre sieht der liberale, demokratische Rechtsstaat aus sehr guten Gründen einen besonderen rechtlichen Schutz vor. Auch daraus begründet sich die rechtliche Stellung der Familie. Diese Sonderrechte sollten aber nicht nur den „normalen“ Familien vorbehalten sein. Das universalistische Grundverständnis verpflichtet den emanzipatorischen Humanismus darauf, sich dafür einzusetzen, dass alle Menschen ein solches Zuhause erhalten können, nach ihren jeweiligen Bedürfnissen, die so unterschiedlich sind wie die Menschen selbst. Auf diese Weise könnte auch verbandspolitisches Handeln ein Zuhause für alle Lebens- und Familienmodelle werden. „Ohne Angst verschieden sein können“ − wäre das nicht ein wünschenswertes Ziel humanistischer Bestrebungen?
Dr. Thomas Lux ist Soziologe. Er lehrt und forscht zu den Themen Lebensverläufe, soziale Ungleichheit und gesellschaftliche Polarisierung. Ab Herbst 2022 ist er Gastprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Dr. Martin Mettin ist Philosoph und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ausbildungsinstitut für Humanistische Lebenskunde beim HVD Berlin-Brandenburg. Er schreibt regelmäßig für humanismus aktuell.
Die beiden Autoren leben seit über zehn Jahren glücklich in wilder Ehe zusammen.
Literatur:
Hatzenbuehler, Mark L. (2011). The social environment and suicide attempts in lesbian, gay, and bisexual youth. Pediatrics 127(5), 896-903.
Mau, Steffen, Thomas Lux und Fabian Gülzau (2020). Die drei Arenen der neuen Ungleichheitskonflikte. Eine sozialstrukturelle Positionsbestimmung der Einstellungen zu Umverteilung, Migration und sexueller Diversität. Berliner Journal für Soziologie 30(3), 317-346.
Der Artikel ist auch als zitierfähiges PDF verfügbar.
Immer auf dem Laufenden bleiben? UNSER NEWSLETTER