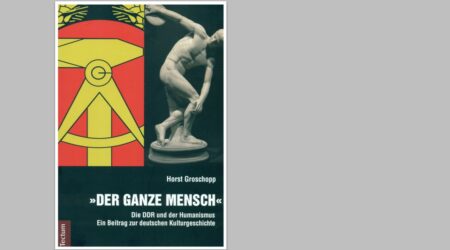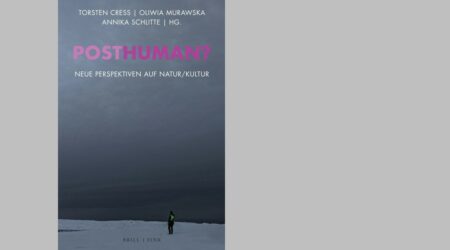Erschienen: 2021
Seiten: 268
ISBN: 978-3-924041-45-8
Rezensent: Horst Groschopp
„Das säkulare Berlin“. Anmerkungen aus Anlass des Erscheinens des gleichnamigen Buches von Manfred Isemeyer
Seit der Erhebung der Berliner Daten zur Einwohnerzählung von 1885, so schreibt Dominik Drießen, Bereichsleiter Öffentlichkeitsarbeit & Mediengestaltung beim Berliner HVD-BB anlässlich der Buchvorstellung am 19. April 2021, „entstand eine säkulare Bewegung, deren Ziel eine humanistische Lebenswelt jenseits christlicher Konfessionen war und ist.“ Das klingt nach Rudolph Penzig und seinem Buch von 1907: „Ohne Kirche. Eine Lebensführung auf eigenem Wege“. An ihn wird auf S. 97 erinnert. Auf die Zielbestimmung „säkulare Lebenswelt“ wird zurückzukommen sein. Der Gegenstand des Buches wird damit klar umrissen: Orte und Menschen außerhalb der christlichen Religion, genauer: in sich davon mehr oder weniger deutlich abgrenzenden Organisationen.
Fern jeder Religion – so hatte es der Vorgänger-Stadtführer noch klarer formuliert. Er beschrieb 2005 die „Metropole des Humanismus“ als „[d]as atheistische Berlin“. Ein Stadtplan für die „[a]theistische Stadtrundfahrt“ war beigefügt. Anlass war damals der 100. Jahrestag der Ausgründung des „Vereins für Freidenker zur Ausführung der Feuerbestattung“ 1905 aus der „Freireligiösen Gemeinde Berlin“. Der Beitritt zum Verein setzte den Kirchenaustritt voraus.
1927 erfolgte die Verschmelzung mit der „Gemeinschaft proletarischer Freidenker“ zum „Verband für Freidenkertum und Feuerbestattung“, der sich 1930 in „Deutscher Freidenker-Verband“ umbenannte und eine Weltanschauungsgemeinschaft wurde. Deren Angebote reichten weit über den ursprünglichen Zweck der „Bestattungskultur“ hinaus. Der Verband wollte seine Mitglieder „von der Wiege bis zur Bahre“ jenseits kirchlicher oder kirchennaher Angebote versorgen. Jedenfalls wurde diese Organisation zum unmittelbaren Vorgänger des heutigen HVD.
Die alte Broschüre hatte einen Umfang von knapp neunzig Seiten, also nur etwa ein Drittel des jetzt vorliegenden Buches. Die Texte stammten ebenfalls von Manfred Isemeyer und Herausgeber war ebenfalls der Berliner HVD. Damals boomten diese besonderen Stadtpläne, weil viele Touristen Bildungstouren unternahmen und etwas Besonderes suchten außerhalb der üblichen Ströme ins Zentrum oder zu den Mauerresten. Zentren gab es aber nun mindestens zwei, wie auch Autobahnhinweise angeben, von den jeweiligen Stadtteilzentren ganz abgesehen.
Zu den bekanntesten Touren dieser neuen Mode gehörten „Jewish Berlin“ von Andrew Roth und „Das Rote Berlin“ von Frank Götze und Dietrich Mühlberg. Während ersterer auch Restaurants, religiöse Stätten und Geschäfte aufführte, widmete sich das „Rote Berlin“ revolutionären Ereignissen und sozialistischen Bewegungen seit 1848. Der Berliner „Tagesspiegel“ und die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ erkannten den möglichen pekuniären Nutzen dieser Tour und verbreiteten den „Stadtspaziergang 7“ unter einem nicht so eindeutigen Label. Sie untertitelten ihr „rote[s] Berlin“ spektakulärer. Sie wiesen die interessierte Kulturbürgerlichkeit auf das hin, was Prolls und Ossis eben auszeichnet und was Wessis so erwarten: „Von Gangsterkriegen und Revolten im rauen Osten – Friedrichshain“.
Isemeyers nun vorliegender Band ist wesentlich anspruchsvoller und gründlich recherchiert. Er enthält eine über dreißigseitige Einführung, 124 Kurzbiographien und nicht mehr lediglich eine Stadtrundfahrt, sondern zwanzig Touren. Am Schluss des Buches findet sich eine Zeittafel mit freidenkerisch-humanistischen Vereinigungen in Deutschland. Dass der Autor freidenkerisch und humanistisch nicht trennen mag, hat wahrscheinlich die zu bändigende Stofffülle zur Ursache. Denn wer sich der Geschichte des Humanismus und seiner Örtlichkeiten wie Öffentlichkeiten extra widmen möchte, muss mit einer überbordenden Flut von Sachangaben rechnen.
Doch ist dies auch beim Gegenstand „säkulares Berlin“ der Fall. Da dieses aber aus der Perspektive von als „säkular“ definierten Organisationen eingegrenzt wird, ist zwar die Einschränkung von „humanistisch“ auf „freidenkerisch“ nachvollziehbar, doch erhebt sich die Frage, was eine „säkulare Organisation“ ist, wenn nicht die Eingrenzung auf „freidenkerisch“ erfolgt. Das ist bei der Lektüre zu beachten, denn dort, wo gewöhnlich gebildete, von diesen Organisationen nichts wissende Personen das Säkulare suchen, führt uns der Stadtführer nicht hin, nicht dorthin, wo Menschen im Alltag jeden Gott verloren haben, ihn nie kannten oder dort nicht finden werden – das normale Berlin.
Darauf kommen wir zurück, nur gleich hier die Pointe: Wer säkularisierende Einrichtungen und Vorgänge beschreiben will, kommt wohl nur schwer zu einem Ende, denn es wird eine moderne Schul- und Kneipengeschichte, eine Rummel- und Kinostory, Radio und Fernsehen spielen eine große Rolle, aber auch ein Schwimmbadpanorama, auch ohne Nacktkultur, die Historie der Zivilgesetzgebung, besonders der Zivilehe usw. usf.
Dass aber bei den „säkularen Organisationen“ ausgerechnet die „Humanistische Gemeinde Berlin“ (HGB, 1887 ff.) und die „Deutsche Gesellschaft für ethische Kultur“ (1892-1936) auf S. 264f. nicht extra genannt werden, verwundert, geht doch die heutige Praxis des herausgebenden HVD von deren Aktivitäten aus, inklusive „Lebenskunde“ und „weltliche Seelsorge“, weniger von den unmittelbaren freidenkerischen Vorfahren.
Dagegen ist erstens der Einwand berechtigt, dass die Leserschaft mit zwei verwandten Organisationen beruhigt wird, der unmittelbaren Ausgründung „Deutscher Bund für weltliche Schule und Moralunterricht“ (1906ff.) und dem dann nicht nur örtlich abwandernden, sondern auch geistig andere Wege gehenden „Deutschen Bund für Mutterschutz [das Folgende fehlt dann im Namen] und Sexualreform“, der zuerst in Richtung „Rassehygiene“, später dann in großen Teilen in die „Rassenhygiene“ abdriftet.
Ein zweiter (noch gewichtigerer) Einwand ist, dass einige wichtige Personen der ethischen Kulturbewegung gewürdigt werden, neben Penzig und Bona Peiser: Lily Braun (leider fehlt ihr Mann: Georg von Gizycki), (der Gründer) Wilhelm Foerster und Georg Siegfried Schäfer (der Gründer der HGB).
Es bringt aber nichts, an einer „Liste der Fehlenden“ zu arbeiten, jedoch ist auf zwei Frauen unbedingt zu verweisen: Zum einen auf Jeanette Schwerin (1852-1899), die Begründerin einer humanistischen Sozialarbeit, aus deren „Auskunftsstelle“ das heutige „Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen“ hervorging; zum anderen auf Lilly Jannasch (1872-1968): Mitbegründerin der „Liga für Moralunterricht“, Graphologin, Feministin, Verlegerin, Journalistin, Pazifistin… – gerade sie gehört zu den wenig erforschten Freigeistern.
Hoffentlich wird es eine Sammelstelle geben, wo Mann und Frau Namen, Orte und Begebenheiten eingeben können für eine neue größere Liste, wobei schon die vorliegende erstaunt. Deshalb sollen hier auch gar nicht in der Art eines strengen Rezensenten Lücken gerügt oder auf etwas, von dem man meint, es könne entfallen, hingewiesen werden. Dafür ist die von Isemeyer vorgelegte Leistung viel zu beeindruckend. Alles Weitere gehört in historische Fachdebatten. Es sei aber angemerkt, dass sich der Rezensent sehr gefreut hat, dass Wolfgang Lüder aufgeführt ist.
Angesichts des Mangels an populärer wissenschaftlicher Literatur zur Freidenkerei zeigt Isemeyers Buch sogar Züge eines Lexikons, dazu mit vielen Bildern und Karten. Es wird unverzichtbar werden und Teile werden sich verselbständigen, wahrscheinlich. Zudem ist das Papier reißfest, man kann die Tourenpläne mit sich führen. Vielleicht kommt später eine App.
Im vorliegenden Werk findet die Leserschaft durchaus eine begründete, aber auch subjektive Sicht auf das „säkulare Berlin“, auf das, was Isemeyer hier sieht – und nicht sieht, auch, weil es schwer abbildbar ist, weil es den Alltag von Leuten meint, die „Sensationen des Gewöhnlichen“, wie es der verstorbene Michael Rutschky einmal genannt hat. Von ihm stammt auch die Formel: „Die DDR entsteht erst jetzt“ – und er meinte eine permanente Transformation der Sichtweisen auf diesen Staat und seine Gesellschaft. Wenn wir nun schon einmal dabei sind: Was im Osten war denn nicht säkular? Und warum fehlen die Verbände? Waren sie nicht alle säkular? Leider gilt auch hier, bis auf wenige Ausnahmen, die Regel: Die DDR hat es nie gegeben. Aber warum ist dort die „säkulare Lebenswelt“ weiterentwickelt als im Westen?
Das wirft die übergreifende Frage auf: Was ist in den Augen von freidenkerischen Humanisten „heilig“ – das Gegenwort zu „weltlich“. Und um es zuzuspitzen: Was an der Kirche ist heute nicht säkular, wo selbst Theologen inzwischen die eigenen Riten sachlich betrachten.
Beim Thema „säkular“ will ich nun abschließend ansetzen. Und wenn ich schon einmal darüber sinniere, was das Säkulare im Leben der Leute ist – zu ihrer Kultur gehört, zu ihren Selbstverständlichkeiten –, dann will ich, um zu umreißen, was ich meine, zunächst auf die Entdeckung dieser nichtreligiösen Welt zu sprechen kommen. Diese Entdeckung ist ebenso Freidenker-, wie Proletariats-, wie Kirchengeschichte. Zum Ende hin will ich dann aber ein Beispiel nennen, warum es dann doch berechtigt sein kann, das „säkulare Berlin“ enger zu fassen, dort aufzusuchen, wo es der Autor tut, in der organisierten Lebenswelt jenseits christlicher Konfessionen.
Armut war bis Anfang des 19. Jahrhunderts kein „Aufreger“, bis um 1830 die Hilflosigkeit im Umgang mit dem frühen Vor-, dem sich erst formierenden Industrieproletariat und eine sesshafte, im „Voigtland“ in Hütten hausende Stadtarmut zum Umdenken nötigte. Diese Entdeckung ist in der sozialhistorischen Literatur umfänglich belegt. Der Blick auf die Unterschichten deckte nämlich zugleich Gegensätze zur gewollten Moral auf. Man sah zuerst vor allem einen Mangel in der religiösen Erziehung. Das ist der Moment, in dem im Volk Säkularität als Ursache von Armut und Elend festgestellt wird. Noch kommen in den Oberschichten aber keine Zweifel daran auf, dass dies eine vorübergehende Erscheinung darstellt.
In Berlin meinte der Armenarzt Thümmel 1827, man müsse „durch Anlegung neuer Kirchen und Fundierung … durch Missionäre, welche vielleicht hier ebensoviel als unter den Südsee-Insulanern zu bekehren bekämen“, den Zuständen der Armut und der sittlichen Verrohung abhelfen.[1]
Dieser Idee folgend entstanden nach 1835 in Berlin wie in anderen deutschen (protestantischen) Gegenden auch, zur besseren Bekehrung und Seelsorge der zu Gemeinden gehörenden Arbeiterklientel, die „Innere Mission“ und die ihr zugehörenden Anstalten. Was die traditionelle Kirche nicht schaffe, müsse von Vereinen und Laien erledigt werden.
Führender Kopf war der Pastor Johann Hinrich Wichern (1808-1881). Er entwarf ein Programm, um den Menschen im schwierigen Alltag Lebenshilfe zu leisten und zugleich sozialkulturelle Forderungen an den Staat zu stellen. Außer den Anstalten der „Diakonie“ (mit freiwilligen Krankenpflegern) und den „Stadtmissionen“ gründete und unterhielt die „Innere Mission“ in der Folgezeit vielerlei Einrichtungen: Kinderkrippen, Kleinkinderschulen, Kinderheilstätten, Rettungshäuser für Verwahrloste, Heilstätten und Asyle für Trunksüchtige und Prostituierte, Vereine für ledige Mütter, Lehrlinge, Gesellen und Jünglinge, Verpflegungsstationen für arme Wanderer (Naturalverpflegungsstationen, Herbergen zur Heimat usw.), Arbeiterkolonien, Mäßigkeits- und Sittlichkeitsvereine.
Diese Einrichtungen waren zweifelsfrei „säkular“. Es half auch nicht, „Arbeiterkirchen“ wie die Sophienkirche in Mitte und andere zu errichten: repräsentative Bauten waren schon damals nicht prall gefüllt. Die Säkularisierungsvorgänge schritten fort. Interessant ist nun, dass die ersten „weltlichen“ (humanistischen) Einrichtungen der DGEK nach 1892 auf gleiche Weise entstehen, dem tradierten Muster folgen. Stichworte sind hier „Settlementbewegung“ und „Universitäts-Ausdehnung“.
Hedwig Penzig, eine Tochter Rudolph Penzigs, gehörte zum engen Mitarbeiterkreis von Friedrich Siegmund-Schultze und zu den 28 Männern und sechs Frauen, meist Studierende, die im Wintersemester 1913/1914 tätig wurden. Ihr Projekt hieß „Frauenkolonie“. Es befand sich in der Fruchtstraße 63. Hedwig Penzig ist sogar eine Schlüsselfigur, wie ihrem Bericht „Unsere beginnende Mädchenarbeit“ entnommen werden kann.[2] Ende 1917 gibt es sieben „Mädchenklubs“, wahrscheinlich sehr „säkular“.
Es beginnt um 1900 zugleich eine allgemeine, bis heute andauernde Tendenz. Im Namen christlicher Einrichtungen werden verstärkt Konfessionsfreie tätig, die überhaupt an Zahl zunehmen (andere findet man z.B. in Ostdeutschland gar nicht). Es vollzieht sich eine „unterirdische“ Säkularisierung, die durch Zwänge kommerziellen Handelns verstärkt wird. Das „säkulare Berlin“ – und durchaus das humanistische – ist also vor allem dort zu finden, wo es nicht auf dem Etikett steht. Das ist in keinem Stadtführer abbildbar.
Die christlichen Klagen über das „säkulare Berlin“ flammen immer mal wieder auf, besonders dann, wenn politische Erfolge etwa des HVD, Anlass dazu geben, den eigenen Leuten Mut zu machen. So beruhigte Bischof Wolfgang Huber 1999 seine Kirchenmitglieder mit einem Artikel in den „Evangelischen Kommentaren“: „Die säkulare Metropole. Die Berliner sind kirchenfern, aber nicht unreligiös“ (Nr. 9, S. 6-10).
Die Schuldigen werden benannt: die Hinterlassenschaften der DDR und der atheistische HVD mit seinem Fach Lebenskunde, zu dem das Land Berlin auch noch Geld gibt. Dann werden so etwa die gleichen Rezepte wie schon 1830ff. vorgeschlagen, nur ohne die Forderung nach neuen Kirchenbauten. Besonders wichtig ist jetzt der Religionsunterricht. Am Schluss kam und kommt immer das Prinzip Hoffnung: „Neue Modelle des missionarischen Gemeindeaufbaus werden erprobt.“ Und: Die „Sehnsucht nach dem Heiligen [wird] neu artikuliert und nach dem christlichen Glauben wieder gefragt“. – Die Geschichte des „säkularen Berlin“, wie sie Isemeyer erzählt, deutet auf das Gegenteil, woran die im Buch beschriebenen Personen und Organisationen sehr schuldig sind.
[1] Zitiert nach Johann Friedrich Geist / Klaus Kürvers: Das Berliner Mietshaus. Bd.1: 1740-1862. München 1980, S. 379.
[2] Hedwig Penzig: Nachrichten aus der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost. Berlin, April 1914, S. 36-38.
Die Rezension ist auch als zitierfähiges PDF verfügbar.
Immer auf dem Laufenden bleiben? UNSER NEWSLETTER