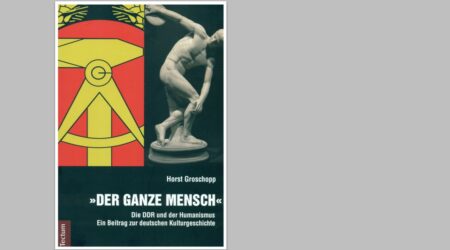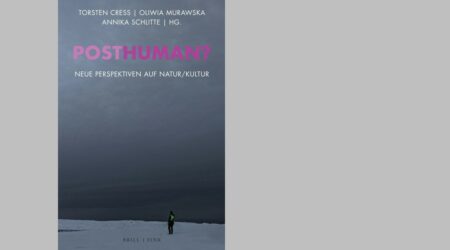Seiten: 544 Seiten
ISBN: 978-3-96289-189-3
Rezensentin: Irina Spiegel
Die frohe Botschaft: Frieden ist die Regel, Krieg – nur eine Ausnahme
Der kanadisch-amerikanische Politikwissenschaftler Christopher Blattman geht in seinem Buch Warum wir Kriege führen. Und wie wir sie beenden können der Dynamik kriegerischer Konflikte auf den Grund. Das Buch ist eine Art Einführung in das Verhandlungsmodell des Krieges, das historische sowie gegenwärtige gewaltsame Konflikte als komplexe Verhandlungsinteraktionen analysiert und interpretiert. Dabei versucht Blattman, die anspruchsvollsten Konzepte aus der Spieltheorie und interdisziplinären Politikwissenschaft einem Laienpublikum verständlich zu machen. Seine Ergebnisse münden in eine gewagte These bzw. Hypothese: Krieg ist eine Ausnahme, nicht die Regel: „Wir schreiben regalmeterweise Bücher über große Kriege und übersehen den eher unscheinbaren Frieden überall. Die blutigen Spektakel, die schockierendsten Ereignisse fesseln unsere ganze Aufmerksamkeit. Die Momente der Ruhe, in denen Kompromisse ausgehandelt werden, geraten hingegen, wenn sie überhaupt registriert werden, schnell in Vergessenheit.“ (19) Es ist nach Blattman ein Fall der selektiven Wahrnehmung, die Anthropologen beim Menschen als eine evolutionäre Konstante ausgemacht haben: Menschen nehmen negative Ereignisse viel intensiver wahr als positive. Blattman möchte hier Aufklärungsarbeit leisten und ein Korrektiv dieser Fehlwahrnehmung liefern, „denn sie entspricht einfach nicht der Realität“. (17)
Blattmanns methodische Idee besteht darin, den Fokus der Analyse zu weiten und dabei nicht nur die großen zwischenstaatlichen Kriege zu betrachten, sondern alle mittels Gewalt ausgetragenen Konflikte. So möchte er verstehen, warum sich eine Gruppe von Menschen auf anhaltende, organisierte Gewalt einlässt, wenn doch die Kosten[1] einer solchen Gewalt für die Beteiligten meistens extrem hoch sind. Es mag unrealistisch klingen, aber die meisten Konfliktgruppen, so Blattmans Analyse und Auswertung einer großen Menge an Daten, legen ihre Konflikte ohne Gewalt bei oder entscheiden sich eher dafür, sich „einander in Frieden zu verachten“ (17). Um die Kosten eines langwierigen Kampfes zu vermeiden, suchen Straßenbanden, Aufständische und auch Staaten in der Regel nach Möglichkeiten, sich zu einigen, anstatt die eigene Zerstörung zu riskieren. Diese Tendenz zum Frieden, so Blattman, scheitert dann, wenn fünf von ihm diagnostizierte Grundfaktoren die Situation zu dominieren beginnen: (1) unkontrollierte Interessen, (2) immaterielle Anreize (z.B. Rache), (3) Selbstbindungsproblem oder commitment problems, (4) Unsicherheit oder Ungewissheit über die Absichten des Gegners und (5) Fehlwahrnehmung.[2] Es sind also für Blattman gar nicht so sehr die Ressourcenknappheit, Armut oder andere normalerweise[3] angeführten Kriegsursachen, sondern diese fünf Grundfaktoren, die den Krieg wahrscheinlicher machen und damit eine mögliche Erklärung dafür liefern, warum Menschen (manchmal doch) Krieg dem Frieden vorziehen. (25-30)
Das klingt sehr abgeklärt rational und positiv überraschend, insbesondere angesichts des gegenwärtigen brutalen Krieges in der Ukraine. Es fühlt sich daher etwas seltsam an, jetzt über den Krieg als Ausnahme nachzudenken. Denn wie Russlands Einmarsch in die Ukraine gezeigt hat, reicht ein einziger Krieg aus, um Tausende von Menschenleben zu vernichten und Millionen weitere zu gefährden. Diejenigen, die sich vor einem Krieg fürchten, tun dies nicht (primär) aufgrund einer falschen Wahrnehmung. Sie tun es, weil Krieg schrecklich ist und es nur natürlich ist, Grausames zu fürchten, auch wenn es nur relativ selten vorkommen mag. Dies widerspricht allerdings nicht Blattmans These vom Krieg als einer Ausnahme: Kriege am eigenen Leibe erleben (und fürchten) und Kriege wissenschaftlich erklären und verstehen zu versuchen, sind zwei völlig verschiedene, jedoch gleichermaßen berechtigte Perspektiven. Die These von der Seltenheit des Krieges bzw. vom Frieden als Regelfall kann den Ukrainer*innen natürlich keinen Trost spenden, und dennoch bleibt zu hoffen, dass ein besseres Verständnis der Kriegsgründe helfen könnte, auch diesen Krieg besser zu verstehen und eventuell schneller zu beenden. (Die Hoffnung stirbt bekanntermaßen zuletzt. Noch so eine anthropologische Konstante.)
Mit der Darstellung des Friedens als Regelfall verfolgt Blattman das Ziel, besser zu beschreiben, warum rivalisierende Mächte ihre Konflikte nicht immer friedlich beilegen können. Trotz des übermütigen Titels bietet das voluminöse Buch jedoch keine eigentliche „Theorie des Krieges“ an. Neben den vielen historischen Beispielen skizziert Blattman lediglich jene fünf Faktoren, die den Krieg wahrscheinlicher machen. In der ersten Hälfte des Buches widmet er ihnen einzelne Kapitel und illustriert sie an Beispielen bewaffneter Konflikte, die er zum Teil selbst als Wissenschaftler und Entwicklungshelfer vor Ort beobachtet hat.[4] Die Intention des Buches ist also viel bescheidener als der Titel suggeriert. Die fünf Gründe sollen nicht als Teile einer neuen Kriegstheorie verstanden werden, die auf einmal andere Theorien ersetzt. (28) Sie bilden vielmehr eine Art „Typologie“ und sollten als Möglichkeit verstanden werden, „eine neue Ordnung in die Unmenge an Theorien und Denkschulen zu bringen, die es bereits gibt.“ (29)
Die fünf Gründe oder Faktoren des Krieges hat Blattman aus der interdisziplinären Forschung herausdestilliert. Im Buch steckt also eine riesige Menge an Forschungsergebnissen aus der Wirtschafts-, Geschichts- und Politikwissenschaft, Soziologie, Psychologie, Kognitionswissenschaft und anderen Wissenschaften der letzten Jahrzehnte.[5] Die fünf Hauptgründe des Krieges entsprechen Blattmans Abstrahierung aus der Menge der ausgewerteten Quellen, Studien und Modelle. Und diese Faktoren stehen nicht einfach nebeneinander, sondern wirken zusammen und verstärken sich gegenseitig. (29) „Unverantwortliche Führungsriegen, immaterielle Beweggründe, Ungewissheit, Selbstbindungsproblem und Wahrnehmungsfehler bilden ein toxisches Gebräu, das den Frieden nach und nach vergiftet.“ (ebd.) „In diesem fragilen Zustand kann ein einziges Missverständnis oder ein einziges katastrophales Ereignis jeden Anreiz, den Frieden zu wahren, beseitigen.“ (ebd.) Blattman ist hochmotiviert, diesen fragilen Zustand besser zu verstehen.
Was ist ein Krieg? – Ein neuer Definitionsversuch
Blattman schlägt eine sehr allgemeine und ungewöhnlich weitgefasste Definition des Krieges vor: Krieg ist nicht nur der „Krieg zwischen Staaten, sondern jede Art langwierigen, gewaltsamen Kampfs zwischen Menschengruppen: zwischen Dörfern, Clans, Banden, ethnischen Gruppen und religiösen Konfessionen, politischen Lagern und letztendlich auch Nationen. So unterschiedlich solche Auseinandersetzungen auch sein mögen, ihre Ursprünge ähneln sich.“ (15) Diese Definition bildet die methodische Strategie Blattmans ab: Er möchte maximal von den Unterschieden innerhalb der großen Vielfalt kriegerischer Auseinandersetzungen abstrahieren, um so die Wurzel aller gewaltsamer Konflikte zu erfassen. Nichts an dieser Strategie ist falsch, wenn man denn gleichzeitig die Komplexität und Vielfalt kriegerischer Konflikte im Hinterkopf behält, was Blattman auch tut.
Kriege spieltheoretisch modellieren?
Die meisten Nationen, politischen Fraktionen, ethnischen Gruppen und Banden verhalten sich strategisch, so Blattman. Er geht also zunächst einmal von der grundlegenden (nicht unbedingt bewussten) Rationalität der Menschen aus. Wie Poker- oder Schachspieler versuchen Menschen, vorauszudenken, die Stärken und Schwächen ihrer Gegner möglichst korrekt einzuschätzen sowie ihre Erwartungen und Pläne zu antizipieren, um Handlungen danach auszurichten. (25) Selbst wenn sie schlecht informiert sind, sich irren, voreingenommen oder emotional sind, wollen sie dennoch das (vermeintliche) beste Ergebnis erzielen. Strategisches Verhalten ist daher kein unplausibler Ausgangspunkt, um über den Krieg nachzudenken. Die Wissenschaft der Strategie ist die Spieltheorie (25), die berechnet, wie sich eine Seite verhalten wird, wenn sie davon ausgeht, was ihr Gegner tun wird (in dem Wissen, dass der Gegner ähnlich denkt).
Zwar arbeitet Blattman mit den Modellen der Spieltheorie, warnt aber gleichzeitig davor, bezüglich des Krieges der Spieltheorie blindlings zu folgen. (25) Manche verwenden deren Modelle, um ein unrealistisches Bild vom Menschen als rationalem Homo oeconomicus zu zeichnen. Aber der Mensch schafft es immer wieder und „entgegen jeder Vernunft, schrecklich gewalttätig zu sein“, weil der Kampf als vermeintlich beste Strategie gesehen wird und die Menschen oft keine kohärenten Überzeugungen haben. (25) Dennoch benutzt Blattman die Spieltheorie als das basale Framework – nicht, weil die Menschen friedliebend und vernünftig sind, sondern, weil sie „primär das tun, was in ihrem Interesse liegt“. (26)
Die fünf Faktoren, die einen Krieg wahrscheinlicher machen
Eine Gesellschaft, ihre Regierungen oder Autokraten ignorieren oft entweder die Kosten des Krieges oder entscheiden sich dafür, sie in Kauf zu nehmen. Ob es sich um Russlands Angriff auf die Ukraine oder die US-Invasionen in Afghanistan und Irak oder Bandenkriege handelt, irgendetwas hat die strategischen Anreize für Friedenserhaltung zunichte gemacht.
Es gibt nach Blattman fünf Hauptgründe,[6] warum der Anreiz für den Frieden schwindet: (1) unkontrollierte Interessen, (2) immaterielle Anreize, (3) Unsicherheit bezüglich der Absichten der Gegner, (4) Verbindlichkeitsprobleme (im Englischen commitment problems, das etwas unglücklich mit „Selbstbindungsproblem“ übersetzt ist) und (5) Fehlwahrnehmung. Jeder dieser Gründe unterminiert die Kompromissbereitschaft, wenn auch auf jeweils verschiedene Art und Weise.
Als Blattman das Buch schrieb, konnte er nicht ahnen (sonst hätte es sicher erwähnt), dass die seit Jahren sich steigernde Konfrontation zwischen Ukraine (bzw. der westlichen Allianz) und Russland eskalieren würde. Warum eigentlich nicht? Sein Ansatz, den Krieg spieltheoretisch und empirisch zu betrachten, war ja bereits da und auch der Krieg in der Ukraine lief schon (seit der Krim-Annexion). Warum gibt es nicht mal eine kurze Erwähnung dazu im Buch? Passt etwa dieser Krieg nicht in das Modell? Wohl kaum. Wahrscheinlich fehlte hier Blattman einfach die nötige Informiertheit über die Lage in der Ukraine (er ist schlicht kein Experte für Osteuropa und Russland). Dennoch können wir das Buch auch in Bezug auf diesen Krieg betrachten, um zu prüfen, ob Blattmans Ansatz wirklich tragfähig ist und uns als solches helfen könnte, besser zu verstehen, warum Putin einen so rücksichtslosen Krieg begonnen hat, und auch ob Blattmans Erkenntnisse reale Möglichkeiten zu einem stabileren Frieden aufzeigen können.
(1) Unkontrollierte Interessen
Gewöhnlich bilden die extrem hohen Kriegskosten den Hauptanreiz für Frieden. Es kommt aber vor, dass Amtsträger, die über einen Krieg entscheiden, sich gegenüber dem Rest ihres Landes nicht rechtfertigen müssen. Sie erhoffen sich persönliche Vorteile von einem Krieg und blenden die Kosten von Kampfhandlungen sowie das damit verbundene Leid für die Bevölkerung rücksichtslos aus. (27)
In Bezug auf den Krieg in der Ukraine gilt tatsächlich: Putin und seine Komplizen haben den Krieg angefangen, weil sie nicht selbst die Kriegskosten tragen müssen, sondern das Volk (oder besser die Völker) Russlands. Unkontrollierte Interessen von Autokraten wie Putin sind ihre privaten. Die Ukraine hatte in den vergangenen zwei Jahrzehnten zwei russlandtreue Regierungen abgesetzt. Während also eine demokratische Ukraine für die einfachen Russen kaum eine Gefahr darstellte, könnte die junge ukrainische Demokratie eine Blaupause für eine Revolte in Russland werden und so Putins Regime stark gefährden. Nach Putins Kalkül kann die Einsetzung einer Marionettenregierung in der Ukraine diese Bedrohung beseitigen. Ein Krieg lag nicht so sehr im Interesse der Bevölkerung Russlands, sondern im Interesse von Putins Regime.
Auch demokratische Gesellschaften sind anfällig für unkontrollierte Interessen, z. B. ein Präsident, der vor den Wahlen seine Popularität steigern will, militärische Führer, die in einem Konflikt ihre Chance sehen. In jedem dieser Beispiele geht es um die Entscheidungsträger, die der Bevölkerung gegenüber kaum oder gar nicht rechenschaftspflichtig sind und mit dem Krieg ihre eigenen (privaten) Interessen verfolgen. (49-75) Unkontrollierte Interessen bilden damit einen plausiblen Grund und sind ein wichtiger Faktor beim Kriegsausbruch (auch in der Ukraine).
(2) Immaterielle Anreize
Manchmal kann ein Krieg einen Vorteil mit sich bringen, wie z. B. Status, Ruhm, Prestige oder Nationalstolz bzw. Patriotismus. Ideelle Belohnungen können die immensen Kosten des Krieges neutralisieren und die Konfliktparteien dazu bringen, Kriege anzuzetteln, anstatt zu verhandeln. Der erwartete Wert des Kampfes steigt dann im Vergleich zum erwarteten Wert des Friedens. Zum Beispiel „Status“: Das Streben nach Ruhm und Dominanz hat Könige in der Vergangenheit und Autokraten in der Gegenwart oft genug in den Krieg getrieben. Dies ist auch ein Teil der Erklärung für Putins Invasion in die Ukraine: Nationalistischer Stolz, Revanchismus und der Wunsch, Russland wieder zu seinem imperialen Ruhm zu verhelfen, haben die extremen Kosten des Krieges übertrumpft. Wenn dies zu Putins persönlichem Ruhm und seinem Platz in der Geschichte beiträgt, umso besser bzw. schlimmer. Ideelle Anreize sind offenbar ein wichtiger Kriegsfaktor. Aber allein ist es lange kein hinreichender Grund dafür, Kriege vom Zaun zu brechen. Nach Blattman ziehen selbst Erzfeinde in der Regel vor, sich in Frieden zu verabscheuen. (Das ist der rote Faden des Buches.)
Ein weiteres Beispiel für immaterielle Anreize ist der ideologische Wert, den eine Gesellschaft einigen Gebieten beimisst. Die Gebiete werden mit der nationalen oder ethnischen Identität verbunden. In solchen Fällen kämpfen Menschen, weil der Gedanke an einen Kompromiss in Bezug auf ein identitätsstiftendes Gebiet (z.B. Krim) unvorstellbar ist. Und unterdrückte Völker kämpfen für ihre Freiheit. Kompromisse sind für sie paradoxerweise existenzgefährdend und identitätserhaltend zugleich: Sie kämpfen bis zum Tod, um zu überleben. Ukrainer*innen lehnten sich gegen eine russische Dominanz auf. Putin verlangte von der Ukraine, dass sie ihre Souveränität teilweise aufgibt. Doch die meisten Ukrainer*innen lehnen diesen Deal bislang ab. Dies ist zumindest das vorherrschende Bild in den deutschen Leitmedien. Sie sind scheinbar bereit, ihr Leben zu opfern, weil ihnen Kompromisse in Bezug auf Freiheit und Souveränität nicht annehmbar sind. Das sind Tendenzaussagen und wenn sie zutreffen, dann reduzieren die immateriellen Anreize tatsächlich die Neigung zum Frieden. Sie engen den Verhandlungsspielraum ein, vor allem dann, wenn es zu einer breiten Solidarisierung innerhalb einer Kriegspartei kommt. Und eine solche Solidarisierung gibt es nicht nur auf der Seite der Ukraine, sondern es kann sie (und wird es wohl) auch auf der Seite der Russischen Föderation geben.
(3) Ungewissheit
Die dritte Wurzel des Krieges ist die Unwissenheit oder Unsicherheit. (118‑156) Ein gewisses Maß an Unsicherheit ist eigentlich stets in den Berechnungen des erwarteten Wertes enthalten. Was aber Blattman meint, ist die asymmetrische Information oder Ungewissheit über Unsicherheit.
Die ersten Monate nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine haben gezeigt, wie schwierig es ist, die Lage richtig einzuschätzen. Die Inkompetenz der russischen Streitkräfte, die Entschlossenheit des ukrainischen Volkes und die weitreichenden Sanktionen des Westens waren allesamt im Voraus ungewiss und dynamisch. Zumindest waren selbst die Expert*innen vom Kriegsausbruch überrascht. Das Problem ist dabei nicht nur die Selbstüberschätzung (overconfidence bias), sondern auch die (prinzipielle) Unvorhersehbarkeit der Situation vor und auch während des Krieges.
Ein Krieg ist so verheerend, dass beide Seiten viel Zeit und Energie investieren, die Stärke des Gegners zu ermitteln. Sie signalisieren sich zunächst ihre Stärke durch Militärübungen, Raketentests und weitere Scharmützel. Und dennoch kannten weder Ukraine noch Russland ihre eigene Stärke wirklich, bevor sie sich nicht im Kampf begegneten. Hinzu kommt, dass man den Informationen des Gegners prinzipiell nicht vertraut. Es ist wie beim Poker, man weiß schlicht nicht, welche Karten der Gegner in der Hand hält, aber man weiß, dass diese Ungewissheit ihm einen Anreiz zum Bluffen gibt. Auch im Krieg kennen die Gegner die Stärken des anderen nicht. Und sie bluffen. In einer solchen Situation ist es aus der spieltheoretischen Sicht optimal, eine sogenannte Mischstrategie zu verfolgen: Mal aussteigen (keine Gewalt riskieren), mal mitgehen (und Gewalt riskieren). Aber wann genau ein Krieg riskiert wird, d. h. wann genau die Unsicherheit tatsächlich den Krieg mitbedingt, kann mittels dieses dritten Grunds auch nicht geklärt (geschweige denn vorhergesagt) werden. (155)
(4) Selbstbindungsproblem (Commitment Problem)
Der vierte Faktor ist die sog „Thukydides-Falle“ oder die Logik des Präventivkrieges. (156-188) Eine aufsteigende Macht kann sich nicht glaubwürdig dazu verpflichten, ihre Macht später nicht einzusetzen, daher sollte man jetzt in den Krieg ziehen, um dies zu verhindern. Unglaubwürdige Verpflichtungen hängen mit dem Fehlen der internationalen Durchsetzungsmechanismen zusammen. Das führt zum Selbstbindungsproblem (commitment problem). Es tritt immer dann auf, wenn eine Seite glaubt, dass ihr Gegner einen Anreiz hat, die Regeln und Verpflichtungen nicht (mehr) einzuhalten. Beide Seiten würden eine Vereinbarung einem ruinösen Krieg vorziehen, aber dennoch ist dieser Vereinbarung nicht zu trauen. Historiker*innen und Politikwissenschaftler*innen beziehen sich oft auf dieses Dilemma, um unterschiedliche Kriege wie den Peloponnesischen Krieg, den Ersten Weltkrieg und die US-Invasion im Irak zu erklären. Auch Putin spricht vom Präventivkrieg.
Nicht nur Autokratien, sondern auch Demokratien haben commitment problems, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Der gewählte Präsident, Wolodymyr Selenskyj, könnte zwar den Friedensvereinbarungen zustimmen, aber etwa ein Jahr später, wenn sich die Umstände ändern, könnte sich die Legislative weigern, die Vereinbarung zu ratifizieren, oder ukrainische Bürger*innen könnten eine Regierung wählen, die die vorherigen Vereinbarungen komplett ablehnt. Auch in diesem Fall kann eine Verhandlung scheitern, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Autokraten wie Putin haben noch größere Schwierigkeiten, glaubhaft Friedensverpflichtungen einzugehen, weil sie nichts daran hindern kann, ihre Entscheidung direkt zu revidieren. Warum sollte die Ukraine den ersten Schritten in Richtung einer Friedensverhandlung zustimmen, wenn sie befürchten muss, dass Putins Regime jede Pause nutzen könnte, um sich neu zu formieren, um dann erneut anzugreifen? Das Selbstbindungsproblem verunmöglicht hier geradezu die Entstehung eines Rahmens für Verhandlungen. Und dennoch ist es nach Blattman wiederum nur ein weiterer Grund dafür, warum Menschen Kriege führen. „Ein Krieg hat selten nur einen Grund.“ (188)
(5) Fehlwahrnehmungen
Der fünfte Grund dafür, warum es zum Krieg kommt, besteht darin, dass Menschen falsche Annahmen aufgrund von Wahrnehmungsfehlern und Falschinformationen treffen und selbst dann daran festhalten, wenn sich die Beweise für deren Gegenteil häufen. (189-238) Menschen schätzen sich selbst oft falsch ein, indem sie ihre eigenen Chancen auf einen Sieg überschätzen oder die Kosten eines Kampfes unterschätzen. Manchmal sind diese Wahrnehmungsfehler psychologischer oder anthropologischer Natur, manchmal sind sie aber auch institutioneller Natur, wenn z.B. Propaganda verbreitet wird und kein hinreichendes Korrektiv (z.B. in Form von Bildungsinstitutionen) vorhanden ist. Menschen sind insbesondere dann anfällig für Fehlwahrnehmungen, wenn der Konflikt auf ethnischen, religiösen oder ideologischen Spaltungen beruht. (208f.)
Eine Seite kann ihre eigene Stärke (oder die des Gegners), die mögliche Reaktion der internationalen Gemeinschaft, den Mut der gegnerischen Führung oder die Bereitschaft der eigenen Bevölkerung, für den Sieg Opfer zu bringen, völlig falsch wahrnehmen. Dieser Faktor wird durch den Anreiz verstärkt, die Wahrnehmung der anderen Seite durch Täuschung, Stimmungsmache und Bluff zu manipulieren. Das erleben wir gerade im Krieg gegen die Ukraine (potenziert durch die sozialen Netzwerke). Dieser Krieg ist zu einem nicht unwesentlichen Teil auch ein Informationskrieg, wo menschliche Vorurteile, Wahrnehmungsfehler und darauf ausgerichtete Fake News (neuerdings auch Deep Fakes) manchmal strategisch wichtiger erscheinen als die letalen Waffen selbst. Kurzum: Kognitive Verzerrungen und Fehlwahrnehmungen beeinflussen die anderen vier Faktoren des Krieges und tragen mit dazu bei, den Verhandlungsspielraum zu verkleinern.
Die von Blattman analysierten fünf Kriegsfaktoren stellen also eine gute Möglichkeit dar, unsere bisherigen Vorstellungen von Kriegen zu überprüfen. Jedes Mal, wenn ein bewaffneter Konflikt unter Bezugnahme auf einen bestimmten Aspekt betrachtet wird, kann man sich fragen: Wie bestimmt dieser Aspekt die Möglichkeiten und Anreize, den Frieden zu erhalten? Wie passt diese oder jene Beobachtung zu den fünf Kriegsfaktoren? Vielleicht sind nicht immer alle fünf relevant? Vielleicht aber auch gar keiner? Denn, es kann auch sein, dass sich Blattman mit seinem Ansatz auch zu sehr auf das (rationalistische) strategische Denken (das beim Krieg ja völlig ins Irrationale kippt) konzentriert und zu wenig auf die Kulturgeschichte und kulturabhängige Narrative kriegerischer Auseinandersetzungen. Und überhaupt: Steckt nicht in dem marktliberalen Narrativ und in der damit zusammenhängenden – von den amerikanischen Think-Tanks so sehr geliebten – Spieltheorie ihrerseits eine (tieferliegende) Wurzel der modernen Kriege? Ist also das spieltheoretische Narrativ nicht selbst ein wesentlicher Kriegsfaktor? Kritische Theorie, beispielsweise, würde eine solche Kritik unterstützen. Aber wir sollten hier vielleicht auch nicht (so sehr) in den „Krieg“ der Theorien oder Ansätze einsteigen und uns eher an der Methodenvielfalt und Pluralität der Perspektiven orientieren, was eher einer humanistischen Einstellung bzw. humanistischen Friedensethik entspricht. Aus dieser humanistischen Perspektive lassen sich Einsichten des Buches (nach einer kritischen Reflexion) durchaus in das Projekt der Friedensethik integrieren.[7] Für diese Herangehensweise spricht auch der zweite Teil des Buches, wo Blattman mit viel Eifer versucht, unter Bezugnahme der vorangehenden Analyse der fünffachen Wurzel des Krieges die praktischen Schritte für eine (funktionierende) Friedenspolitik zu formulieren.
Die Wege zum Frieden
Im zweiten Teil des Buches versucht Blattman nun, konkrete politische Präventivmaßnahmen zu formulieren, die den Verhandlungsspielraum weiten und damit den Krieg unwahrscheinlicher machen können, wobei er direkt einen oder mehrere der oben beschriebenen fünf Faktoren miteinbezieht.
Die erste kriegspräventive Idee ist die sogenannte „Interdependenz“. (244‑268) Die Idee ist uralt und insbesondere Montesquieu hat sie bereits 1748 klar ausformuliert. (252) Erfolgreiche Gesellschaften sind in der Regel intern und extern wirtschaftlich, sozial und kulturell verwoben (heute mehr denn je), was allerdings den Krieg nicht gänzlich ausschließen kann. Das hat uns die Invasion Russlands in der Ukraine noch mal deutlich vor Augen geführt. Auch wenn zwei Gruppen mehr oder weniger interdependent sind, können immer noch das commitment problem, Unsicherheit oder unkontrollierte Interessen der Amtsträger die Gruppen zum Krieg animieren. Aber aufgrund der geteilten (in der Regel bis heute leider rein wirtschaftlichen) Interessen ist die Anziehungskraft des Friedens dann doch etwas stärker ausgeprägt. Diese Logik funktioniert bislang in Bezug auf China, sie funktionierte jedoch nicht in Bezug auf Russland: Die Interdependenz war hier wahrscheinlich nicht hinreichend oder nicht symmetrisch genug, etwa aufgrund der wirtschaftlichen Schwäche Russlands.
Die zweite präventive Maßnahme gegen den Krieg ist nach Blattman die Machtkontrolle und Machtteilung. (269-288) Eine stabile Gesellschaft hat in der Regel viele Zentren. Auch diese Idee ist alt. Blattman bezieht sich z.B. auf James Madison (der Vater des Checks-and-Balances-Prinzips in den USA, 278). Machtteilung bringt die Entscheidungsträger dazu, Kriegskosten als geteilt zu denken. Damit reduziert sich die Wahrscheinlichkeit für unkontrollierte Interessen. Wenn die Macht auf verschiedene Personen und Institutionen verteilt ist, hängen die Entscheidungen nicht mehr von einem (evtl. kriegstreibenden) Herrscher ab. Ähnliches gilt auch in Bezug auf die Fehlwahrnehmungen. In einem zentralistischen Regime ist ein Land der verzerrten Wahrnehmung einer einzigen „Machtvertikale“ ausgeliefert, wie im heutigen Russland. Die Machtkontrolle bzw. Machtteilung führt dazu, dass alle fünf Faktoren, die den Krieg wahrscheinlicher machen, „weniger ins Gewicht fallen“ (276). Der Frieden, so Blattman lapidar, ist polyzentrisch. (281) Nur klingt es wie Hohn, wenn Putin Ähnliches sagt und eine multipolare Weltortung einfordert.
Die dritte allgemeine Kriegsmaßnahme bilden die Regeln oder Gesetze und ihre Durchsetzungskraft. (289-312) Dabei ist der Staat selbst der größte Friedensbringer. (297f.) Blattman bezieht sich dabei teilweise auf Thomas Hobbes, der den stabilisierenden Wert eines effizienten, neutralen Dritten begründete, welcher allein die Gesetze durchsetzen kann. Eine solche staatliche Institution ist allerdings bei Hobbes absolutistisch (nicht polyzentrisch) konzipiert, damit sie (nach Hobbes) auch eine maximal glaubwürdige Drohung ausstrahlen kann, weil sie (allein) die notwendige Sanktionsgewalt haben kann, um Gesetzesbrüche wirklich zu bestrafen. Gesetze und die glaubwürdige Androhung ihrer Durchsetzung halten die privaten Interessen der Gewalttäter in Schach und wirken den immateriellen Anreizen für Krieg entgegen. Sie stoppen zwar nicht (lange nicht) die innerstaatliche Gewalt, „aber sie erweitern zumindest den Verhandlungsspielraum zwischen lokalen Akteuren“ (299). Soweit folgt Blattman Thomas Hobbes. Was er allerdings bei Hobbes kritisiert (neben der Notwendigkeit eines absoluten Machtzentrums), ist, dass er einen grundlegenden Anreiz für Frieden bei Menschen übersehen hat. „Die Menschen konkurrieren zwar um Reichtum, Ehre […] oder Macht, da hat Hobbes recht, aber sie würden es vorziehen, den anderen nicht töten, unterwerfen oder vertreiben zu müssen. Denn all das ist gefährlich und teuer.“ (301)
Das Problem ist hier nur, dass es auf der internationalen Ebene keine hinreichend mächtige Durchsetzungsgewalt gibt, so dass internationale Systeme quasi-anarchistische Ordnungen bilden. (305) Blattman zitiert in diesem Zusammenhang Albert Einstein, welcher der Ansicht war, dass eine Weltregierung, d.h. der bedingungslose Verzicht der Staaten auf einen großen Teil ihrer Souveränität, der einzige Weg zum internationalen Frieden ist. (307) Für Blattman ist eine Weltregierung jedoch völlig unrealistisch und er meint, dass „zum Glück [..] eine Weltregierung nicht der einzige Weg zum Frieden“ ist, wobei „irgendeine Art von internationalen Institutionen“ gebraucht wird, um die Regeln festzulegen und ihre Einhaltung durchzusetzen. (308) Er nennt in diesem Kontext den Völkerbund und die Vereinten Nationen, um ihnen im selben Absatz keine gute Funktionalität zu bescheinigen. Es ist unbefriedigend, wenn Blattman sagt: Es ist dennoch besser, sie zu haben als sie nicht zu haben. Er versucht dann im vierten Punkt (Interventionen) mühselig Belege dafür zu liefern, dass das UN-System doch irgendwie ein bisschen zum Frieden beiträgt, auch wenn es letztendlich den Krieg nicht verhindern kann.
Die vierte Maßnahme ist nach Blattmann die „Intervention“, die v.a. Sanktionen und die Entsendung von Friedenstruppen umfasst. Bei der Frage, ob Sanktionen wirklich den Frieden befördern können, lässt er die Leser*in ratlos zurück, indem er sagt, Sanktionen sind „wirklich schwer auszuwerten“ (327), weil hier die Vergleichsstudien gänzlich fehlten. Die Alltagsstatistik sagt hier jedoch, dass sie eigentlich nicht funktionieren: Iran, Afghanistan, Nordkorea, Russland. Die Frage, die dann die Sanktionierenden beantworten müssen, ist: Warum werden überhaupt so massiv Sanktionen verhängt?
Eine ähnliche Geschichte erzählt Blattman auch in Bezug auf die Entsendung von Friedenstruppen und Friedensmissionen. Ihre Erfolge sind bescheiden, und dennoch bemerkt er: „Friedenstruppen tragen zur Festigung des Friedens bei, sie sind häufig nicht so gut, wie sie sein könnten, aber im Allgemeinen machen sie schlechte Situationen ein wenig besser.“ (339) Blattman bezieht sich hier auf ein engagiertes Wissenschaftsteam aus der Columbia University, das eine fundierte Studie zu Effektivität der Friedenstruppen durchführte. Darin wurden Bürgerkriege mit und ohne Friedenstruppen verglichen. Es stellte sich heraus, dass Friedenstruppen die Lage in der jeweiligen Kriegsregion dauerhaft beruhigen können. Doch die Wissenschaftler*innen konnten das selbst erst gar nicht glauben und suchten in dieser Studie nach Verzerrungen, z.B., indem Friedenstruppen evtl. in relativ unkomplizierte Kriegskonflikte entsendet wurden. (So wenig traute man den Friedenstruppen zu.) Aber das Team fand umgekehrt Anzeichen dafür, dass Friedenstruppen eher in die schwierigen Regionen geschickt werden. Die Korrelation zwischen Beruhigung der Lage und Anwesenheit der Friedenstruppen müsste stärker sein, als man gemessen hatte. „Im Allgemeinen scheinen größere, längere und mit mehr Befugnissen ausgestattete Missionen die Opferzahlen zu reduzieren und ein Übergreifen des Konflikts auf die benachbarten Gegenden zu verringern.“ (340) Also gibt es hier eine Evidenz und damit auch Hoffnung. Und wo bleibt dann eine dementsprechende (evidenzbasierte) internationale Politik? Denn: „Auch wenn die Friedenstruppen kein Allheilmittel sind, lassen ihre immerhin vorhandenen Erfolge darauf schließen, dass es in den letzten dreißig Jahren wahrscheinlich weniger Kriegstote gegeben hätte, wenn die Welt in mehr und größere Friedensmissionen investiert hätte.“ (341) Die Wissenschaft spricht zumindest dafür, die Friedenstruppen deutlich zu stärken. „Größere, rechenschaftspflichtige und repräsentative Sicherheitskräfte gehören zum Weg, der zum Frieden führt.“ (342) Dabei sollten die UN-Friedensmissionen nicht auf die sogenannten „Friedenstruppen“ reduziert werden. Die meiste und wohl die wichtigste Arbeit wird von der „kleinen Armee von Zivilisten“ geleistet: Schlichtung von alltäglichen Streitigkeiten, Aufbau von Verwaltungsstrukturen, humanitäre Versorgung, Verhandlungen organisieren oder durchführen, Bereitstellung von Informationen und Verfahrensweisen, Wahlen organisieren, aber auch mit Terroristen und Kriegsverbrechen (ja, mit diesen auch!) sprechen, gehört zur undankbaren, ambivalenten, aber essentiellen Friedensintervention oder besser – Friedensarbeit.
Und dennoch ist es frustrierend, Blattmans Ausführungen zu den Präventivmaßnahmen zu lesen. Denn das alles ist nicht neu. Frustrierend ist es auch, weil es sehr viel Friedensforschung gab (mehrere Friedens- bzw. Konfliktforschungsinstitute in Deutschland) und zu wenig von der praktischen, ganz konkreten Friedenspraxis (vor Ort); und noch frustrierender ist es, weil die benannten vier Maßnahmen international nur halbherzig (wenn überhaupt) durchgeführt wurden bzw. werden – abgesehen von den mehr oder weniger drakonischen Sanktionen, die vermutlich nur die Ärmsten treffen. Der Krieg in der Ukraine wurde durch Friedensforschung nicht verhindert, v.a. auch weil internationale Institutionen sehr schlecht gegenüber Großmächten wie den USA und Russland funktionieren. Und dennoch spricht sich Blattman – ermutigt durch seine Analyse der fünf Kriegsfaktoren – für die vorhandenen internationalen Institutionen wie die UN aus, weil wir ohne sie noch schlechter dastünden. Aber lassen sich denn aus Blattmans Analysen nicht etwas radikalere Reformen dieser Institutionen entwickeln? Ich würde das bejahen. Blattman jedenfalls tut das nicht. Er ist ein Hardcore-Realist und glaubt nicht an weitreichende Reformen, weil diese mit der relativ starken Reduzierung nationalstaatlicher Souveränität einhergehen, was heutzutage kein einziger Staat der Welt haben möchte.
Die 10 Gebote einer kleinschrittigen Friedenspolitik
Anstelle von Reformvorschlägen bietet Blattman im Nachwort des Buches die zehn Gebote einer kleinschrittigen Friedenspolitik, nach welchen sich jeder oder jede richten sollte, der oder die eine Friedensarbeit leisten möchte. (395) Sie sind so simpel und trivial (wie z.B. „Werte deine Erfolge aus.“ oder „Du sollst dich in Geduld üben.“), dass sie hier nicht weiter ausgeführt werden müssen. Blattman gibt selbst zu, dass sie „ziemlich simpel klingen“ (396), meint aber daraufhin, dass auch die biblischen 10 Gebote sehr simpel seien, z.B. „Du sollst nicht töten“. Blattmans Buch zeigt m.E. an dieser Stelle eine große Schwäche: Wozu überhaupt diese Analogie mit den biblischen Geboten? Blattmans Gebote sind Plattitüden. Ihnen fehlt völlig der Charakter einer notwendigen „Agitprop“, sie sind also in keine (nicht mal eine minimale) Vision eingebunden. Warum muss Friedensarbeit überhaupt so kleinschrittig und so dermaßen unambitioniert sein? Zeigen nicht die fünf von Blattman analysierten Faktoren, d.h. die neueren interdisziplinären Erkenntnisse sowie auch das Scheitern der Friedensordnung in Europa, dass die internationalen Institutionen und damit zusammenhängenden Friedensinterventionen dringend und grundlegend reformiert werden sollen? Ist es nicht höchste Zeit, eine neue „Friedensinternationale“ zu formulieren? Blattmann ist wohl zu sehr in ökonomischen, marktliberalen Modellen der Spieltheorie und den entsprechenden Bias gefangen, als das er hier irgendetwas Derartiges – wenigstens im Ansatz – formulieren könnte. Wie auch immer, aber diese 10 Gebote könnten höchstens (wenn überhaupt) den jungen zivilen Helfer*innen in den Anfänger-Workshops eine gewisse praktische Orientierung geben. Aber keines der 10 Gebote wird helfen, nach Auswegen aus dem Ukraine-Krieg zu suchen, und schon gar nicht kann Blattman Inspirationen für eine neue „Friedensinternationale“ liefern. Die ca. 100 Jahre alten Texte aus der Feder von Bertha von Suttner enthalten hierfür unvergleichlich mehr Potenzial!
Fazit
Blattman schafft es mit seinem klaren, anschaulichen und informierenden Stil, die Leser*innen mit dem Verhandlungsmodell des Krieges vertraut zu machen und aufzuzeigen, wie in Krisengebieten die jeweilige Steigerung der Kriegswahrscheinlichkeit minimiert werden könnte. Denn: Frieden ist letztlich das, was die meisten Menschen anstreben, auch wenn Putins Krieg uns gerade etwas anderes zu suggerieren versucht. In Anbetracht der Häufigkeit des Auftretens der fünf Kriegsfaktoren können wir nicht erwarten, dass der globale Frieden bald eintritt. Kant jedenfalls war in seiner Altersschrift Zum ewigen Frieden hier auch ziemlich skeptisch, allerdings nicht ohne ein ironisches und damit ermutigendes Augenzwinkern. Kant hat das, was Blattman im zweiten Teil des Buches schildert, bereits in seiner kleinen Schrift auf diejenige Art und Weise angedacht (nämlich unglaublich visionär), dass im Vergleich mit Kants geschliffenen und kompakten Text das dicke Buch etwas aufgebauscht und aufgebläht wirkt. Man kann dennoch sagen: Blattman liefert diejenigen logischen Erklärungen, historischen Deutungen und empirischen Evidenzen, die Kants Gedanken nicht nur stützen, sondern auch präzisieren. Er bestätigt die kantische Skepsis bezüglich der Möglichkeiten einer Weltregierung und untermauert mittels Methoden der modernen Wissenschaft Kants Gedanken zu den Bedingungen der Möglichkeit dauerhafter Friedensverträge. Und so ist das Buch den friedenspolitisch engagierten Humanisten*innen durchaus zu empfehlen, denn es liefert nützliche Einsichten und Informationen dafür, wie die gegenwärtige, international ausgerichtete Friedensarbeit zumindest intensiviert – wenn auch nicht reformiert – werden könnte.
Anmerkungen
[1] Obwohl Blattman oft mit den monetären Beispielen arbeitet, beinhaltet der Begriff „Kosten“ bei ihm nicht nur finanzielle oder wirtschaftliche Ausgaben, sondern auch alle möglichen nicht monetären Verluste in einer Gesellschaft (z. B. Menschenleben, Gesundheit, Wohlstand im weitesten Sinne). Das ist nicht unproblematisch, denn eigentlich lässt sich die Spieltheorie nicht ohne quantifizierbare Kriterien betreiben. Dies ist ein ungelöstes (normatives) Kernproblem der Spieltheorie im Allgemeinen und Blattmans Ansatzes im Besonderen.
[2] Die fünf Faktoren oder Gründe werden weiter unten ausführlicher behandelt.
[3] Blattman hat Gründe für seine provokative These: Daten, die er bezüglich „Armut und Krieg“ ausgewertet hatte, zeigen offenbar, dass Armut als Kriegsfaktor überbewertet werde.
[4] Blattman war in der Sozialarbeit mit Gangs in Chicago, mit Clans in Medellín (Kolumbien) und in Friedensprojekten in Liberia sowie Uganda tägig. Das heißt, er war zunächst sozial engagiert, und zwar in denjenigen Bereichen, in welchen er dann etwas später intensiv zu forschen begann.
[5] Die Anmerkungen (zu den Quellen) und Literatur umfassen mehr als 50 Seiten. Das ist beachtlich.
[6] In der Übersetzung steht tatsächlich das Wort „Ursache“ für das Wort reason, das im amerikanischen Original steht. Diese Wortübersetzung ist nicht nachvollziehbar, denn Blattman möchte keine Kausalitäten in Bezug auf den Krieg formulieren, es geht ihm lediglich um die logischen „Gründe“ oder „Bedingungen“, die den Verhandlungsspielraum so einengen, dass ein Krieg wahrscheinlicher wird, jedoch nicht verursacht. Es ist nur ein Beispiel für die durchgehend nicht gelungene Übersetzung des Buches. Diejenigen, die des amerikanischen Englischen mächtig sind, sind aufgerufen, das Buch im Original zu lesen, denn Blattman schreibt in einem luziden und auch für Nicht-Muttersprachler*innen verständlichen Amerikanisch.
[7] Vgl. Ralf Schöppner (Hrsg.): Wie geht Frieden? Humanistische Friedensethik und humanitäre Praxis, Alibri Verlag, Aschaffenburg 2017.
Die Rezension ist auch als zitierfähiges PDF verfügbar.
Immer auf dem Laufenden bleiben? UNSER NEWSLETTER