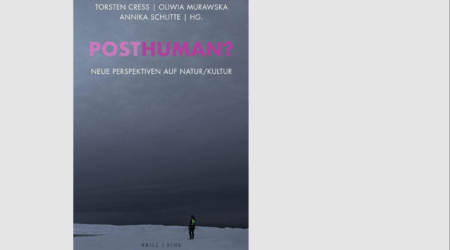Foto: GR Stocks | unsplash.com
Sterbehilfe: Bundestag contra Bundesverfassungsgericht!
Wie der Bundestag nach dem besten Weg sucht, das Urteil des BVerfG zu unterlaufen
von Norbert Groeben
1. Problem/These
Das Bundesverfassungsgericht hat 2020 den bisherigen Paragraphen (217 des Strafgesetzbuchs) zum ‚Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe‘ für verfassungswidrig erklärt, weil dieser das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben „faktisch weitgehend entleert“ hat [1]. Dieses Recht resultiert aber aus dem im Grundgesetz verankerten allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1) in Verbindung mit dem Art. 1, Abs. 1 („Menschenwürde“). Daraus lässt sich die Notwendigkeit einer veränderten Gesetzgebung ableiten, durch die das Recht „des Einzelnen, seinem Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen“ [2], gewährleistet wird. Das impliziert auch das Recht, „hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen.“ [3] Zugleich hat das Bundesverfassungsgericht allerdings festgehalten, dass es das Recht und die Pflicht des Staates ist, das Leben seiner Bürger*innen zu schützen. Im Zusammenhang mit dem selbstbestimmten Sterben kann man darunter den Schutz vor Fehlentscheidungen (z.B. einem sog. Affekt-Suizid) verstehen. Die bisher (2022) vorliegenden drei Gesetzentwürfe von überfraktionellen MdB-Gruppierungen (Castellucci et al.; Helling-Plahr et al.; Künast et al.) konzentrieren sich allerdings in einem solchen Ausmaß auf diese Schutzfunktion, dass sie de facto – wieder – das Recht auf einen selbstbestimmten Tod erheblich einschränken. Letztlich sucht der Bundestag auf diese Weise, so meine These, nur nach dem besten Weg, wie sich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts unterlaufen lässt.
Die beiden Aspekte, die durch diese Vorrangstellung der Schutzfunktion unterlaufen bzw. letztlich negiert werden, betreffen das Ausmaß und den Umfang der individuellen Autonomie, die sowohl für das Leben als auch das Sterben des Einzelnen gelten (sollen). Bezüglich des Umfangs der Autonomie hat das Bundesverfassungsgericht explizit festgehalten: „Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist nicht auf bestimmte Situationen wie schwere oder unheilbare Krankheitszustände oder bestimmte Lebens- und Krankheitsphasen beschränkt. Es besteht in jeder Phase menschlicher Existenz.“ [4] Zugleich ist das Ausmaß der Autonomie durch den je subjektiven Wertehorizont des Lebenssinns bestimmt, der vom Sterbewilligen definiert und nicht von außen, d.h. von Dritten, be- und damit entwertet werden darf: „Die Entscheidung des Einzelnen, dem eigenen Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, entzieht sich einer Bewertung anhand allgemeiner Wertvorstellungen, religiöser Gebote, gesellschaftlicher Leitbilder für den Umgang mit Leben und Tod oder Überlegungen objektiver Vernünftigkeit.“ [5]
Diese beiden essenziellen Autonomieaspekte werden durch die genannten (vorliegenden) Gesetzentwürfe des Bundestags nicht adäquat berücksichtigt, weil darin übereinstimmend eine Beratungspflicht mit Aufklärung über medizinische Behandlungsalternativen vorgesehen ist. Die Gesetzentwürfe gehen also im Widerspruch zum BVerG-Urteil zum einen doch von der bestimmten Situation einer (schweren) Krankheit aus und implizieren zum anderen durch die Pflicht zur Teilnahme an einer Beratung die Konfrontation mit „allgemeinen Wertvorstellungen“ bzw. „objektiver Vernünftigkeit“. Form und Inhalt der vorgesehenen Beratungspflicht unterlaufen auf diese Weise die vom Bundesverfassungsgericht festgehaltene Autonomie und laufen darauf hinaus, dass das Recht auf selbstbestimmtes Sterben abgesehen von schweren Krankheitszuständen wiederum „faktisch weitgehend entleert“ wird (s.o.). Durch die bisherigen Gesetzentwürfe stellt sich der Bundestag also letztlich gegen das BVerfG-Urteil und negiert gerade die existenzielle Essenz dieses Urteils.
2. Analyse
(1) Die bisherigen Gesetzentwürfe sehen übereinstimmend eine Beratungspflicht vor: Im Entwurf von Künast et al. wird eine zweimalige Beratung („im Abstand von mindestens zwei und höchstens zwölf Monaten“) gefordert (§ 4 (3). Bei Castellucci et al. wird „mindestens ein individuell angepasstes, umfassendes und ergebnisoffenes Beratungsgespräch“ (§ 217 (2) 3.) vorausgesetzt. Bei Helling-Plahr et al. heißt es zunächst (in § 4 (1)): „Jeder […] hat das Recht, sich zu Fragen der Suizidhilfe beraten zu lassen.“ Dieses Recht erweist sich aber später in § 6 (3) als Pflicht: „Der Arzt hat sich durch Vorlage der Bescheinigung nach § 4 Absatz 7 nachweisen zu lassen, dass sich die suizidwillige Person höchstens 8 Wochen zuvor in einer Beratungsstelle hat beraten lassen.“ Und inhaltlich umfasst diese Beratung nicht zuletzt „Handlungsalternativen zum Suizid“, das sind auch potenziell „in Betracht kommende alternative therapeutische Maßnahmen und pflegerische oder palliativmedizinische Möglichkeiten“ (§ 4 (2), 2.) Im Entwurf von Künast et al. ist explizit von einer „gegenwärtigen medizinischen Notlage“ die Rede (§ 3 (1)). Bei Castellucci et al. wird vergleichbar als notwendiger Bestandteil des Beratungsgesprächs die Aufklärung über „Möglichkeiten der medizinischen Behandlung und Alternativen zur Selbsttötung“ angeführt (§ 217 (2), 3b).
Durch die primäre Fokussierung auf die Schutzfunktion sind also die Möglichkeiten eines rationalen Suizids außerhalb von Krankheitssituationen praktisch völlig aus dem Blickfeld geraten. Diese vom Bundesverfassungsgericht explizit angesprochenen Möglichkeiten habe ich in meinem Buch Sterbenswille. Verteidigung des rationalen Suizids und Sterbebeistands [6] auszubuchstabieren versucht und dabei neben dem (vom Krankheitszustand ausgehenden) Leidens-Suizid noch die Varianten eines Präventiv-, Bilanz- und Symbiose–Suizids expliziert, die auch an historischen Beispielen veranschaulicht werden. Ein Präventiv-Suizid liegt idealtypisch vor, wenn eine Person bei beginnendem Persönlichkeitszerfall (z.B. aufgrund einer Demenz) durch den Suizid den völligen Identitätsverlust vermeiden will. Im Fall des Bilanz-Suizids sieht die Person ihren Lebenslauf als vollendet an und verspürt keine Energie mehr, das Leben fortzusetzen (von anderen auch als ‚Lebenssattheit‘ bezeichnet: vgl. Roßbruch [7]). Beim Symbiose-Suizid ist der häufigste Fall sicherlich, dass eine Person aufgrund von Leiden stirbt oder Suizid begehen will und der/die Partner*in ohne diese (geliebte) Person im Weiterleben keinen Sinn mehr sieht. Damit wird an dieser Form des Suizids besonders eindrücklich deutlich, dass der Sterbenswunsch nicht nach ‚allgemeinen Wertvorstellungen oder objektiver Vernünftigkeit‘ bewertet werden darf; denn man kann sicher fragen, ob eine solche symbiotische Verbindung ‚vernünftig‘ ist; aber wenn sie von zwei Menschen eingegangen und ein ganzes Leben gelebt worden ist, ist sie „im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren.“ [8] und fällt damit unter die generelle Unzulässigkeit, vom Sterbewilligen „weitere Begründung oder Rechtfertigung“ zu verlangen). Dieser Respekt wird jedoch durch Form und Inhalt der in den vorliegenden Gesetzesentwürfen vorgesehenen Beratungspflicht gerade nicht realisiert, sondern den Sterbewilligen in entmündigender Weise versagt.
Bei solch existenziellen Fragen wie Suizid und Sterbehilfe reichen allerdings erfahrungsgemäß rein kognitive Argumente, so gut ausgearbeitet sie auch sein mögen, zur Veränderung von Überzeugungen nicht aus. Um die Überwertigkeit der Schutzfunktion in den vorliegenden Gesetzesentwürfen aufzuheben, sollen die hier vorgebrachten Argumente daher durch veranschaulichende Beispiele ergänzt werden, an denen die Problematik der Beratungspflicht auch emotional offensichtlich wird. Die Beispiele sind als idealtypische konzipiert, d.h. sie stellen prototypische Möglichkeiten für die drei jenseits des Leidens-Suizids explizierten Fälle (Präventiv-, Bilanz-, Symbiose-Suizid) dar.
(2) Man stelle sich also als Beispiel für den Präventiv-Suizid einen Philosophen vor, dessen Lebenswerk in der logischen Rekonstruktion klassischer philosophischer Positionen besteht. Die bedeutendsten historischen Ansätze der Philosophie hat er logisch analysiert und mit formal-logischen Mitteln auf ihren Aussagenkern konzentriert. Das erlaubt eine differenzierte Analyse der Stärken, aber auch Schwächen der einzelnen Positionen, so dass die Nachhaltigkeit ihrer jeweiligen Wirkung in der Philosophiegeschichte präziser durchschaubar wird. Durch eine beginnende Demenz verliert dieser Wissenschaftler aber zunehmend die für ihn zentrale Fähigkeit der formal-logischen Analyse und Rekonstruktion. Es gibt erste Erfahrungen, dass er seine eigenen Arbeiten nur mit Mühe versteht; im Prinzip ist er sich sogar unsicher, ob er sie wirklich in jedem Schritt richtig versteht. Das einzig Sichere ist für ihn, dass er selbst bei Problemen, die er schon einmal erfolgreich rekonstruiert hat, jetzt versagen würde. Damit ist für ihn die Grenze überschritten, jenseits der das Leben für ihn seinen Sinn verliert. Seine Identität besteht für ihn aus seinem wissenschaftlichen Lebenswerk, das ihm zu entgleiten droht.
Was soll es angesichts eines solchen Sterbewillens für Beratungsmöglichkeiten in Richtung auf alternative Handlungs- bzw. Behandlungsvorschläge geben? Will man ihn ernsthaft darauf hinweisen, dass durch moderne Behandlungsmöglichkeiten das Fortschreiten der Demenz verlangsamt werden kann? Oder dass sein Lebenswerk doch gedruckt vorliegt und von seinen Schüler*innen fortgeführt werden kann? Dass es so viele andere erfüllende Lebenserfahrungen gibt, in Natur und Kultur? Was immer auch an Beratungsversuchen an ihn herangetragen würde, er müsste mit verzweifelter Intensität sagen: „Sie haben mich nicht verstanden! Das, was mir jetzt schon entgleitet, ist mein Leben, das und nur das allein! Sie können doch nicht von mir verlangen, dass ich meinem geistigen Absterben tatenlos zusehe! Und es am Schluss nicht einmal mehr als solches wahrnehmen werde…!!“ Das aber heißt: Jeder Beratungsversuch würde unvermeidbar in der Notwendigkeit enden, dass er seine Motivation darstellt, dass er Begründungen vorbringt, Rechtfertigungen. Beratungspflicht bedeutet letztlich Rechtfertigungspflicht! Eine solche Rechtfertigungspflicht in Bezug auf einen rationalen, d.h. aus individuellen persönlichkeitszentralen Werthaltungen entspringenden Sterbenswillen widerspricht jedoch der Menschenwürde – wie vom Bundesverfassungsgericht eindeutig klargestellt.
(3) Gleiches gilt auch für den Bilanz-Suizid. Von außen mag das bisweilen schwer einzusehen sein, auch und gerade, wenn es sich um eine positive Bilanz handelt. Ein mittelständischer Unternehmer zum Beispiel, der die kleine Schrauben-Firma seines Vaters durch verschiedene neue Patente zu einem weltweiten Marktführer in diesem speziellen Segment ausgebaut hat. Das Unternehmen steht nicht zuletzt durch den stabilen Export auf gesicherten Beinen, so dass er es in seinem 70. Lebensjahr seiner technisch begabten Tochter übergeben konnte, die mit großer Kreativität in die Fußstapfen ihres Vaters tritt. Er selbst kann sich nach dem Tod seiner Frau einen lang gehegten Wunsch erfüllen und mit dem Wohnmobil all die Sehenswürdigkeiten Europas besuchen, von denen er schon immer geträumt hat. Sieben Jahre führt ihn seine Entdeckungsreise von Gibraltar bis Hammerfest, von Breslau (der Geburtsstadt seines Großvaters) bis zur D-Day-Küste in der Normandie. Zunehmend fällt ihm aber das Reisen schwer, er hat auch das Gefühl, dass er die Natur- und Kulturwunder, die er kennen lernt, nicht mehr mit der emotionalen Wachheit verarbeiten kann, die ihn zu dieser Reise bewogen hat. Er ist nicht mehr neugierig genug, eigentlich insgesamt auch auf das Leben als solches nicht. Er hat sein Lebenswerk vollendet, es ist in guten Händen, seine Energie ist verbraucht; und ohne Ziel und Sinn bloß noch weiter zu existieren, ist seine Sache nicht. Es wird Zeit, dem Leben Ade zu sagen.
Auch hier: Soll er sich rechtfertigen dafür, dass sein Leben ein glücklich erfülltes war? Sicher, sein Rheuma plagt ihn mehr und mehr, aber nicht so, dass er sich bei entsprechender medizinischer Hilfe nicht damit arrangieren könnte. Aber das ist nicht das Entscheidende. Es fehlt das Interesse. Seine Faszination für das Technische ist nur mehr Erinnerung; selbst wenn er wollte, er könnte gar nicht zurück, er ist viel zu lange aus dem Gebiet heraus, das sich auch weiterentwickelt hat… Natürlich würde ihn seine Tochter liebevoll in die eigene Familie aufnehmen, in der auch nur mehr ihr jüngster Sohn im Hause ist. Sie drängt ihn geradezu, aber in Pantoffeln vor dem Fernseher einzuschlafen, das ist nicht die Vorstellung, die er von seinem Lebensende hat, seit jeher nicht. Nein, er hat seine anonyme Beerdigung bereits geregelt, damit Tochter und Enkel in ihren positiven Erinnerungen an ihn nicht durch nervige Pflichten der Grabpflege gestört werden. Es ist alles gerichtet, jetzt ist es gut…
(4) Die subjektive Individualität der Weltsicht und -bewertung erreicht beim Symbiose-Suizid eindeutig sein Maximum. Wenn etwa eine Frau mit ihrem unheilbar erkrankten Mann gemeinsam in den Tod gehen will, manifestiert sich darin in der Regel eine lebenslange Gemeinsamkeit, die auch im Sterben nicht verloren gehen soll. Sie haben zum Beispiel nie ihren Hochzeitstag gefeiert, sondern nur den Jahrestag jener Entscheidung zu einer gemeinsamen Wohnung, die sich schlussendlich als Beginn der symbiotischen Lebensgeschichte erwiesen hat. Der Jahrestag auf der Burgruine, die sich in den letzten 50 Jahren überhaupt nicht verändert hat, das ist der Vorteil von Ruinen, dass sie in ihrem Verfallszustand bewahrt werden und deshalb am besten dem Zahn der Zeit widerstehen. Dort hat sie ihm, mit dem schweifenden Blick über die sanften Hügel ihrer gemeinsamen Wahlheimat, vor zehn Jahren zum ersten Mal erklärt, dass sie im Falle eines Falles ohne ihn nicht weiterleben möchte, nicht weiterleben kann. Er hat protestiert, selbstredend, mit Nachdruck, und mit dem eigentlich unabweisbaren Argument, dass Liebe das Leben des geliebten Menschen nicht begrenzen will, schon gar nicht so endgültig. Aber wenn sie doch ohne ihn keinen Platz in dieser Welt für sich fühlt… Jetzt, angesichts des eigenen Todes, hat er diesen einzigen Dissens zwischen ihnen nicht mehr ausgehalten – und an ihrem 50. Jahrestag zugestimmt, als dieses paradoxe Geschenk, das sie von ihm am intensivsten erhofft hat.
Sie muss lächeln, wenn sie daran denkt, dass sich alle höchstwahrscheinlich etwas Falsches vorstellen dürften, wenn sie auf die Frage nach der Begründung dieses Suizids die Antwort verweigern würde, mit dem Hinweis, dass das zu persönlich, zu intim sei… Zu intim heißt für sie, nicht erst jetzt im fortgeschrittenen Alter, dass sie sich immer schon über die gleichen Ungerechtigkeiten in dieser Welt erregt haben, und nicht nur über Ungerechtigkeit, sondern auch über mangelnde Ästhetik, fehlendes Sprachgefühl. Das ist es: Ohne seine sprachliche Sensibilität, die sie so oft schwerelos macht, ohne seine Argumente, die im größten Nebel Konturen zu schaffen vermögen, ohne seine Ironie, die jeden Schmerz zu distanzieren weiß: ohne all das mag, kann sie die Welt, das Leben nicht ertragen. Das ist die Erotik jenseits jeder Sexualität, die im Laufe der Jahre gewachsen und gewachsen ist, eine Erotik, ohne die das Leben für sie den zentralen, nein den einzigen Sinn verliert…
(5) Die drei Beispiele zeigen nachdrücklich, dass bei Sterbewilligen außerhalb von schwerer Krankheit unweigerlich die Frage nach den – nicht unmittelbar einsichtigen – Beweggründen und damit ein Rechtfertigungsdruck auftaucht. Eine Beratungspflicht führt in der Praxis also zu einer nicht legitimen Rechtfertigungspflicht, mit der die zu respektierende Autonomie des Individuums in Bezug auf das selbstbestimmte Sterben verletzt wird. Diese Verletzung verstößt auch deshalb eindeutig gegen die Würde der Sterbewilligen, weil in den Fällen von Präventiv-, Bilanz- und Symbiose-Suizid gar keine sinnvollen Beratungsansätze gegeben sind. Abgesehen von Aufklärung über die (medizinischen) Schritte zur Durchführung eines selbstbestimmten Suizids würden mögliche Beratungsansätze die individuellen Beweggründe des/r Sterbewilligen unter Rückgriff auf anderweitige „gesellschaftliche Leitbilder“ oder Aspekte „objektiver Vernünftigkeit“ (s.o. Bundesverfassungsgericht) in Frage stellen. Wenn man gemäß dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts das Recht auf einen selbstbestimmten Tod in jeder Lebensphase (auch außerhalb von „medizinischen Notlagen“) akzeptiert, darf man keine Beratungspflicht einführen, weil mit der daraus folgenden Rechtfertigungspflicht die Autonomie der individuellen Beweggründe konterkariert und das heißt das Recht auf selbstbestimmtes Sterben „in jeder Lebensphase“ – erneut – „weitgehend entleert“ würde.
3. Konsequenzen
(1) Eine adäquate Umsetzung des BVerfG-Urteils kann also lediglich ein Beratungsangebot, keine Beratungspflicht Mit einem solchen Beratungsangebot ist eine gleichgewichtige Realisierung der beiden zentralen Ziele bei der Gesetzgebung zur Sterbehilfe möglich: nämlich zum einen, dass der Staat die Autonomie des selbstbestimmten Sterbens respektiert; und zum anderen, dass er das Leben seiner Mitglieder so weit wie rational verantwortbar schützt. Für diese Schutzfunktion sind wiederum zwei essenzielle Aspekte anzusetzen: Das eine ist – vor allem im Krankheitsfall – die Aufklärung über therapeutische Behandlungsmöglichkeiten als Alternative zu einem Suizid-entschluss; das andere ist die Bewahrung vor Fehlentscheidungen, in denen sich nicht Autonomie, sondern Fremdbestimmtheit auswirkt. In Bezug auf die Aufklärung über therapeutische (medizinische wie psychologische) Behandlungsmöglichkeiten braucht es keine Beratungspflicht. Denn im Krankheitsfall ist davon auszugehen, dass die Patient*innen im Rahmen der Therapieversuche bereits eine je spezifische, sinnvolle Aufklärung erhalten. Hier kann und sollte der Gesetzgeber mehr Vertrauen in das von ihm selbst organisierte Gesundheitssystem haben, in dem sowieso mit der möglichst guten therapeutischen Versorgung auch eine möglichst optimale Kommunikation aller Therapieschritte und -möglichkeiten verbunden sein soll. Und wenn der eine oder die andere Kranke sich nicht optimal beraten und aufgeklärt fühlt, reicht ein (kostenloses) Beratungsangebot (für eine Zweit- oder Drittmeinung etc.) völlig aus. Die Schutzfunktion des Staates ist hinsichtlich der Aufklärung über therapeutische Behandlungsalternativen durch ein (kostenloses) Beratungsangebot als zusätzliches Element in unserem Gesundheitssystem voll und ganz erfüllt, eine Beratungspflicht braucht es dazu nicht.
(2) Sehr viel schwieriger und komplizierter ist selbstverständlich der Schutz vor Fehlentscheidungen. Hier ist der Staat letztlich mit einem Dilemma konfrontiert: Wie soll er Fehlentscheidungen zu verhindern versuchen, wenn er die Begründungen für die Suizidentscheidung nicht bewerten und deshalb schon gar nicht erfragen darf? Ist das nicht letztlich ein Widerspruch: Einerseits soll sich die inhaltliche Begründung des Sterbewillens der („objektiven“) Bewertung von außen entziehen; jedem Einzelnen ist die subjektive Rationalität seiner Werthaltungen zuzugestehen! Anderseits beruht aber die Verhinderung von Affekt-Suiziden auf der inhaltlichen Bewertung des Suizidwunsches als („objektiv“) irrational, gerade nicht von persönlichkeitszentralen und -überdauernden Werthaltungen getragen? Dieses Dilemma lässt sich innerhalb der Inhaltsdimension ersichtlich nicht (auf-)lösen. Es bleibt nur, auf eher formale, indirekte Indikatoren für eine überdauernde Werthaltung überzugehen. Das kann dann nur die Stabilität, die zeitliche Konstanz des Sterbewillens sein. Um seine Schutzfunktion auszuüben, bleibt dem Staat die inhaltliche Bewertung von individuellen Werthaltungen verwehrt, das zeitliche Überdauern solcher Haltungen, zu denen auch die Position gegenüber einem selbstbestimmten Sterben zählt, ist aber der indirekte Indikator, durch dessen Sicherung der Staat seine Schutzfunktion auszuüben berechtigt und verpflichtet ist.
(3) Dementsprechend enthalten auch alle vorliegenden Gesetzentwürfe Regelungen zu einer solchen Stabilitätssicherung des Suizidwunsches, allerdings ohne die Einsicht, dass diese in Verbindung mit einem Beratungsangebot zur Erfüllung der staatlichen Schutzfunktion völlig ausreicht. Das liegt nicht nur an der skizzierten, kritisierten Übergewichtung der Schutzfunktion, sondern auch an einem auf Abwehr ausgerichteten Bild vom rationalen Suizidwunsch und ‑entschluss. Die vom Bundesverfassungsgericht in den Mittelpunkt gestellte Autonomie des Individuums wird von den vorliegenden Gesetzentwürfen nicht wirklich akzeptiert, obwohl gerade auch die empirischen Untersuchungen zur Motivation von Suizidwilligen zeigen, dass bei ihnen die Autonomie an erster und zentraler Stelle steht (z.B. in den zwei Jahrzehnten Erfahrung mit Sterbehilfe in Oregon, vgl. [9]). Daraus lässt sich im Gegensatz zu dem negativen, von Misstrauen geprägten Bild der Gesetzesentwürfe ein positives Bild von Menschen mit Suizidwunsch herleiten. Idealtypisch handelt es dabei nämlich um Personen, für die eine Entscheidung zum rationalen Suizid zu den persönlichkeitszentralen Werthaltungen gehört, die sich im Laufe der Lebensgeschichte längerfristig aufgebaut haben. Man sollte daher zuallererst die Möglichkeit berücksichtigen, dass es sich bei der Stabilität der Suizidentscheidung um eine jahre- oder sogar jahrzehntelange Werthaltung handelt. Auf diese Möglichkeit ausgerichtet gibt es dann eine ganz einfache und sichere Überprüfungsvariante: nämlich, dass von diesen Personen, ähnlich wie es für Patientenverfügungen eingeführt ist, eine Sterbeverfügung (schriftlich) erklärt wird, die z.B. jedes Jahr erneuert wird. Wenn es dann am Schluss tatsächlich um das Lebensende geht, liegt eine maximal stabile, über Jahre oder Jahrzehnte andauernde Stabilität vor – mehr Sicherheit für die Schutzfunktion des Staates kann es im Prinzip gar nicht geben!
Und an dieser Stelle sollte der Gesetzgeber eine weitere Misstrauenseinstellung aufgeben. Denn der optimale Ort für die Abgabe (und permanente Erneuerung) einer solchen Sterbeverfügung sind sicherlich Vereine, die (unter anderem) auch eine Sterbehilfe anbieten. Deren Mitglieder sind in überwältigendem Ausmaß gerade Menschen, die sich frühzeitig mit dem Problem des eigenen Todes auseinandergesetzt und für ein selbstbestimmtes Sterben entschieden haben. Der Gesetzgeber sollte dieses empirische Faktum adäquat berücksichtigen und die bisherige unberechtigte Misstrauenshaltung aufgeben; denn durch eine konstruktive Kooperation mit diesen Vereinigungen lässt sich die Schutzfunktion des Staates am besten realisieren. Stattdessen behalten die bisherigen Gesetzentwürfe die fast paranoide Misstrauenshaltung des alten (aufgehobenen) § 217 StGB bei. Dessen Überziehung des Misstrauens wird unter anderem daran offenbar, dass darin ein ‚auf Wiederholung ausgerichtetes Handeln‘ als ‚geschäftsmäßige Sterbehilfe‘ klassifiziert wird, obwohl Sterbehilfevereine in keiner Weise aus ihrem Hilfsangebot Profit zu schlagen trachten. Dagegen wird in anderen gesellschaftlichen Bereichen z.B. einem auf Wiederholung ausgerichteten Verhalten keineswegs mit vergleichbarem Misstrauen begegnet. Wenn ich ehrenamtlich Asylant*innen Deutschunterricht gebe, dann ist das selbstverständlich auf Wiederholung bei immer neuen Schüler*innen ausgerichtet, gerade wenn ich damit Erfolg habe. Und bei einem ehrenamtlichen Training von Jugendmannschaften im Fußball kann ich sogar eine Trainerpauschale in der Steuererklärung geltend machen, ohne mich dem Verdacht einer geschäftsmäßigen Hilfe auszusetzen. Vergleichbar sollte der Staat zur Kenntnis nehmen und akzeptieren, dass es keineswegs das Ziel einschlägiger Vereinigungen ist, möglichst viele Menschen zum Suizid zu bewegen, sondern dass es nur darum geht, Personen mit einem rationalen Sterbewillen ein friedliches selbstbestimmtes Sterben zu ermöglichen: nach einem ebensolchen Leben, das auch nach der Zielsetzung der zu Sterbehilfe bereiten Institutionen möglichst lange und glücklich dauern sollte. Sterbehilfe und Suizidprävention sind keine Antipoden, sondern zwei Seiten der lebenslangen individuellen Autonomie (nur eben ohne Ausschluss des Lebensendes)!
Eine unideologische Analyse der auf Autonomie ausgerichteten Stabilität von Sterbenswillen führt also zu der Konsequenz, dass der Gesetzgeber in diametraler Abkehr vom bisherigen Misstrauen als (erstem) Königsweg eine vertrauensvolle Kooperation mit Sterbehilfevereinen etablieren sollte, weil die Schutzfunktion des Staates durch eine (jährlich erneuerte) Sterbeverfügung im institutionellen Rahmen einer solchen Vereinigung am sichersten zu erfüllen ist.
(4) Nun kann man sicherlich nicht von allen Sterbewilligen verlangen, dass sie sich bereits lebenslang mit dem Problem des selbstbestimmten Sterbens auseinandergesetzt haben (und eine Vereinszugehörigkeit kann man natürlich schon gar nicht unterstellen). Es ist selbstverständlich legitim, sich erst im Angesicht eines absehbaren Lebensendes mit der Autonomie im Sterbeprozess zu beschäftigen und sich für einen (rationalen) Suizid und Sterbebeistand zu entscheiden. Für diesen Fall steht als (zweiter) Königsweg die ebenfalls längerfristige Einbettung in eine Hausarztbeziehung offen (wie sie z.B. in den Niederlanden als häufigstes Prozedere realisiert wird, vgl. [10]). Eine solche Hausarztkultur wird seit geraumer Zeit auch im deutschen Gesundheitssystem angestrebt. Damit ist auf jeden Fall bereits eine intensive Beratung in Bezug auf Therapiemöglichkeiten verbunden, soweit es sich um eine längere Krankheitsgeschichte handelt. Vor allem aber ist ärztlicherseits eine valide Einschätzung der Werthaltungen auf Patientenseite möglich, ohne dass dafür problematische Befragungs- oder Überprüfungssituationen nötig sind. Auch hier sollte der Staat mehr Vertrauen in die selbst inaugurierte Struktur des Gesundheitssystems haben und auf das hausärztliche Urteil vertrauen. Eine der Schutzfunktion des Staates genügende Stabilitätssicherung des Sterbewillens bedarf in diesem Fall auch nicht unbedingt patientenseitig der schriftlichen Festlegung (wie bei den angesprochenen Sterbeverfügungen). Die hausärztliche Attestierung eines überdauernden Sterbewillens wird so der Autonomie von Personen gerecht, denen die mündliche Kommunikation geläufiger und persönlichkeitszentraler ist als die schriftliche. Eine solche Attestierung erfüllt durchaus auch die Anforderung an die schutzgarantierende Stabilitätssicherung, wenn es sich nicht um eine schwere Krankheitssituation handelt, weil die Verarbeitung der bisherigen Krankengeschichte auf beiden Seiten die Werthaltungen gegenüber Leben wie Sterben offenbart haben dürfte. Bei eventuellen Unsicherheiten auf ärztlicher Seite, vor allem im Falle von Präventiv-, Bilanz- oder Symbiose-Suiziden, ist allerdings sicher eine kooperative Beratung mit psychologischen bzw. psychotherapeutischen Kolleg*innen möglich und angeraten.
(5) Eine solche Kooperation ist zudem unbedingt vorzusehen, wenn der Eindruck einer situationsbedingten Suizidalität besteht, die gerade nicht zeitüberdauernd auf persönlichkeitszentralen Werthaltungen aufbaut. Das gilt sowohl für die Stabilitätssicherung im Rahmen von institutionell abgesicherten Sterbeverfügungen als auch für das ärztliche Attestieren aufgrund einer hausärztlichen Vertrauensrelation. Die Vermeidung von kurzschlüssigen Affekt-Suiziden ist der einzige Fall, bei dem aus der Stabilitätssicherung eine -überprüfung wird. Entscheidend ist dabei, dass es sich hier – negativ – um das Ausschließen von inadäquaten Suizidmotiven handelt, nicht um die – positive – Bewertung von Motivationen als sinnvoll und adäquat. Im konkreten Einzelfall wird es sicher eines sensiblen Vorgehens bedürfen, um bei einem Eindruck von potenzieller Affekt-Suizidalität nicht in einen die individuelle Autonomie negierenden Rechtfertigungsdruck für den/die Suizidwillige*n abzurutschen. Dabei könnte ein Aspekt hilfreich sein, der im Optimalfall grundsätzlich für alle Betreuungen von suizidwilligen Personen gelten sollte: nämlich die kommunikative Einbeziehung des sozialen Umfelds. Diese Einbeziehung sollte, wenn immer möglich, auch und gerade von der zum Suizid entschlossenen Person (mit) initiiert werden, weil darin zum einen auch die Tragfähigkeit des Suizidwunsches in Interaktion mit emotional relevanten Bezugspersonen thematisch wird, und zum anderen, weil dadurch diesen Bezugspersonen die Verarbeitung des Überlebens existenziell erleichtert wird.
4. Fazit
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil 2020 den § 217 StGB („Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe“) als verfassungswidrig aufgehoben, weil er in der Praxis letztlich die Autonomie des Einzelnen in Bezug auf ein selbstbestimmtes Leben wie Sterben verhindert. Zugleich hat das Gericht dem Staat das Recht und die Pflicht attestiert, das Leben seiner Mitglieder zu schützen. Allerdings setzen Geist und Buchstaben des Urteils ganz eindeutig die Autonomieperspektive an die erste und die Schutzperspektive an die zweite Stelle. Die bisher vorliegenden Entwürfe des deutschen Bundestags zu einer gesetzlichen Neuregelung der Sterbehilfe kehren diese Gewichtung jedoch um und konzentrieren sich vor allem auf die Schutzfunktion. Dadurch wird das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in seinem zentralen Sinn unterlaufen und die Autonomie des selbstbestimmten Sterbens – wiederum – unzulässig eingeschränkt.
Diese Einschränkung betrifft sowohl Umfang wie Ausmaß der individuellen Autonomie. Vom Umfang her konzentrieren sich die bisherigen Gesetzentwürfe vor allem auf die Situation der schweren (paradigmatisch unheilbaren) Krankheit und vernachlässigen damit die Feststellung des Bundesverfassungsgerichts, dass das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben in „allen Lebensphasen“ gilt, weswegen auch der Präventiv-, Bilanz- und Symbiose-Suizid unter dieses Recht fallen. Das Ausmaß der individuellen Autonomie manifestiert sich nach dem BVerG-Urteil nicht zuletzt darin, dass ein Sterbewille subjektive Werthaltungen widerspiegelt, die nicht nach „gesellschaftlichen Leitbildern“ oder unter Rückgriff auf Aspekte der „objektiven Vernünftigkeit“ be- und hinterfragt werden dürfen. Dieser Festlegung des Bundesverfassungsgerichts widersprechen die Gesetzentwürfe, indem sie eine Beratungspflicht vorsehen, die in der Praxis gerade für Suizide außerhalb von Krankheitssituationen auf einen Rechtfertigungsdruck hinauslaufen.
Eine adäquate Umsetzung des BVerfG-Urteils muss also, gerade unter Einbeziehung der Fälle von Präventiv-, Bilanz- und Symbiose-Suizid, auf eine Beratungspflicht verzichten. Es versteht sich von selbst, dass damit erst recht (a fortiori) die erneute Regelung durch einen Paragraphen im Strafgesetzbuch (wie im Gesetzentwurf von Castellucci et al. vorgesehen) ausgeschlossen ist. Das wäre eine Überziehung der Schutzfunktion des Staates, die dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts eindeutig widersprechen würde. Zur Ausübung dieser Schutzfunktion ist vielmehr auf die Sicherung der Stabilität des Sterbewillens (als Ausschluss von nur situationsbedingten Affekt-Suiziden) abzuheben; dieser eher formale Indikator repräsentiert die Vorrangstellung der individuell-subjektiven Autonomie, ohne sie „objektiven Bewertungen“ zu unterwerfen, und realisiert zugleich so weit wie möglich die legitime Schutzfunktion des Staates.
Daraus folgt für die Gesetzgebung, dass eine Verbindung von Beratungsangebot und Sicherung der Stabilität des Sterbewillens am besten das Gleichgewicht von Respektierung der individuellen Autonomie und legitimer Schutzfunktion des Staates zu verwirklichen in der Lage ist. Für die Stabilitätssicherung sind in der Praxis zwei Königswege möglich: zum einen die schriftliche Sterbeverfügung, z.B. im Rahmen eines auch Sterbebeistand umfassenden Vereins. Hier sollte der Gesetzgeber sein bisheriges Misstrauen in eine vertrauensvolle Kooperation umwandeln, bei der beide Seiten gleichermaßen das Ziel einer Verhinderung von kurzschlüssigen Affekt-Suiziden verfolgen. Der zweite Königsweg besteht in der hausärztlichen Attestierung einer zeitlichen, überdauernden Suizidintention, die auf der hausärztlichen Vertrauensrelation basiert und vor allem der Autonomie von Menschen mit Schwergewicht auf der mündlichen, interpersonalen Kommunikation entspricht. Für beide Königswege gilt allerdings selbstverständlich, dass bei einer potenziellen Gefahr von rein situationsbedingter Suizidalität eine kollegial-kooperative Beratung mit psychologischer oder psychiatrischer Expertise angeraten ist.
Die hier zusammengestellten Argumente geben unverzichtbare Aspekte für die Umsetzung von Geist und Buchstaben des BVerG-Urteils an. In welchem Ausmaß und in welcher Form daraus gesetzliche Bestimmungen abzuleiten sind, ist eine offene Frage. In der Schweiz ist der ärztlich-assistierte Suizid zum Beispiel ohne eine spezielle rechtliche Regelung eingeführt. In der BRD geht das Urteil des Bundesverfassungsgerichts allerdings letztlich davon aus, dass es statt des aufgehobenen § 217 StGB eine neue, veränderte Gesetzgebung geben sollte. Diese sollte jedoch unbedingt die Schutzfunktion des Staates mit der grundgesetzlich garantierten individuellen Autonomie (auch beim Sterben) so verbinden, dass nicht erneut das Recht auf selbstbestimmtes Sterben dadurch verfassungswidrig eingeschränkt wird!
Norbert Groeben ist emeritierter Ordinarius für Allgemeine und Kultur-Psychologie der Universität Köln, Honorarprofessur für Allgemeine Literaturwissenschaft der Universität Heidelberg und der Universität Mannheim. Zahlreiche Wissenschaftstheoretische, kulturpsychologische und gesellschaftskritische Publikationen (auch unter dem literarischen Pseudonym Ben Roeg).
Anmerkungen
[1] (BVerfG 2020b, Urteil des Zweiten Senats vom 26. Februar 2020 – BvR 2347/15-, Rn 264).
[2] (BVerfG 2020a, Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung verfassungswidrig. Pressemitteilung Nr. 12/2020 vom 26. Februar 2020, I., 1.b).
[3] (BVerfG 2020a, Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung verfassungswidrig. Pressemitteilung Nr. 12/2020 vom 26. Februar 2020, I., 1.).
[4] (BVerfG 2020a, Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung verfassungswidrig. Pressemitteilung Nr. 12/2020 vom 26. Februar 2020, I, a), bb)).
[5] (BVerfG, 2020a, Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung verfassungswidrig. Pressemitteilung Nr. 12/2020 vom 26. Februar 2020, I, a), bb)).
[6] Norbert Groeben (2021). Sterbenswille. Verteidigung des rationalen Suizids und Sterbebeistands‘, wbg-Academic.
[7] Robert Roßbruch (2022). Statement zum Berliner Appell. https://www.dghs.de/fileadmin/content/07_presse/01_Presseerklaerungen/pdf/21022022_Statement_Rossbruch.pdf (20.07.2022)
[8] (BVerfG 2020b, Urteil des Zweiten Senats vom 26. Februar 2020 – BvR 2347/15-, I., 1., bb).
[9] Groeben 2021, S. 184.
[10] Groeben 2021, S. 188ff.
Der Aufsatz ist auch als zitierfähiges PDF verfügbar.
Immer auf dem Laufenden bleiben? UNSER NEWSLETTER