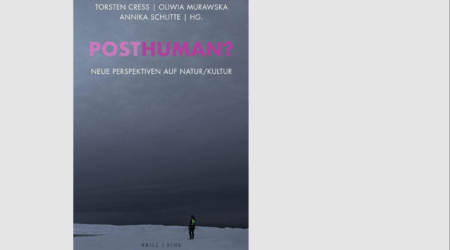Seiten: 398
ISBN: 978-3-88975-266-6
Rezensent: Horst Groschopp
Spuren gelebten Lebens
Die Autorin ist eine durch zahlreiche Publikationen und Studien, darunter solche über informelle Siedlungen in Lateinamerika und den Vereinigten Staaten sowie über politische Ökologie, ausgewiesene Ethnologin. Die vorliegende Studie entstand nach ihren Studien in Sachsen und Thüringen (2000-2003) während ihrer Promotion an der Humboldt-Universität zu Berlin (2006-2009), wo sie sich mit Stadtforschung, Postsozialismus und Museologie beschäftigte, mit einem Schwerpunkt auf der praktischen Erinnerungspolitik im heutigen Deutschland, speziell in Berlin (Spazi di memoria nella Berlino post-socialista, Milano 2012; 2. Auflage 2019).
Ebenfalls 2019 stellte die Autorin einige „Nach-Forschungen“ an, die dann zum vorliegenden, deutschsprachigen Buch führten (Übersetzung: Dorothea Krauss). Die Darstellung erfasst vor allem die Zeit 1990 bis 2010. Es werden zahlreiche Dokumente referiert. Über die Quellen gibt ein Anhang ausführlich Auskunft (vgl. S. 368-398, inklusive Personenregister).
Erst kürzlich hat Susan Neiman als Philosophin auf Basis ihrer teilnehmenden Beobachtung einen umfänglichen Vergleich der US-amerikanischen und deutschen Vergangenheitsaufarbeitung, besonders der Kulturen des Rassismus in beiden Ländern, vorgestellt und ihrem 2020 erschienenen Buch den programmatischen Titel gegeben: „Von den Deutschen lernen“. Sie kommt darin auch auf die DDR zu sprechen, wie deren Gesellschaft „mit dem Bösen in ihrer Geschichte“ umging. Entgegen diversen anderslautenden Urteilen findet sie lobende Worte. Doch wie sieht es mit den Erinnerungen an die DDR selbst in der heutigen Öffentlichkeit aus, in der sie mitunter noch immer als das Böse schlechthin erscheint?
Dreißig Jahre nach dem Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes wirft deren Erbe fortgesetzt einige ungelöste identitätspolitische Fragen auf, die sich in den Widersprüchen im neuen Berlin paradigmatisch spiegeln, wie Candidi anschaulich schildert. Sie geht diesen Problemen akribisch nach und untersucht die verschiedenen Formen und Ausdrucksweisen des Gedächtnisses in Bezug auf die DDR in der deutschen Hauptstadt.
Die Dynamiken der öffentlichen institutionellen Erinnerung werden mit individuellen Gedächtnisstrategien verglichen, wobei zerbrechliche Mechanismen der Vergangenheitskonstruktion ans Licht kommen. Der interdisziplinäre Ansatz der Autorin entdeckt Spuren in der Stadt, die über die öffentlichen historiographischen, musealen und medialen Repräsentationen hinausreichen, indem sie zahlreiche – teils sehr private – DDR-Bilder vorstellt: Sprachmuster, Fotos, Denkmale, Orte und andere Zeugnisse. Fast 250 Interviews gaben ihr intime Einblicke in fünf „Gedächtnisräume“, die die aktuelle erinnerungspolitische Ordnung konstituieren: das städtische, das museale, das institutionelle, das mediale und schließlich das private Gedächtnis. Damit sind fünf Gegenstände der sechs Kapitel des Werkes bezeichnet.
Eine ethnologische Studie muss in die realen Erscheinungsweisen des Kulturellen eintauchen. Sie überzeichnet nicht nachträglich „kämpfende“ Prinzipien oder Theorien, sondern schaut auf das Untergründige der großen Linien, wie sie sich zeigen und was sie deuten wollen bzw. sollen. Sie sind keine Illustrationen, etwa der Beseitigung der Folgen einer Diktatur oder Folgen einer „Friedlichen Revolution“ (die Autorin bleibt beim Begriff der „Wende“), sondern Bilder und Worte, Ausdrücke des Lebens selbst
Vielleicht liegt das Besondere ihres Blickes auch darin, dass die Autorin Italienerin ist und wenig befangen in deutsch-deutschen Befindlichkeiten. Das zeigt sich besonders in ihrer Analyse der offiziellen „Einrichtungen des Erinnerns“ (Kapitel IV), etwa den Umgang mit den Stasi-Unterlagen und wie hier die „Geschichte der Besiegten“ vorgeführt wird und sich im Geschichtsunterricht widerspiegelt.
Das erste Kapitel widmet sich der in der Literatur umfänglich überstrapazierten Kategorie des „Gedächtnisses“, die inzwischen eine Domäne der Medien, ja einer Gedächtnis-Industrie“ geworden sei. Sie zeichnet den Begriffswandel seit der Antike nach und verweist auf dessen Inflation in Gesellschaft und Theorien.
Den Wandel des städtischen Gedächtnisses und die kollektive, politisch motivierte Beseitigung eines eindeutigen Kennzeichens der der DDR erzählt Candidi am Ersatz des „Palastes der Republik“ durch den Neubau des Stadtschlosses der Hohenzollern, dessen Begleitdebatten sie referiert. Das neue Zentrum symbolisiere die versuchte Rückkehr nach Preußen. Auch die massenhaften Straßenumbenennungen (von Babeuf bis Zetkin) seien erfolgreiche Versuche, ein bestimmtes Gedächtnis auszulöschen und eine „Demütigung des Ostens“ (Daniela Dahn) baulich dauerhaft zu markieren. Candidi geht auf die Mauerwander- und Radfahrwege ein und auf die schändliche Verhökerung des Kulturparks Plänterwald.
Ein Reiz ihrer Darstellung besteht in der Beschreibung von Widerständigkeiten gegen die neue Erinnerungskultur und die gezielte Beseitigung alter Symbole, aber auch in den Schilderungen spontaner Aneignungen des Alten und Neuen durch öffentliche Zeichen, etwa Graffitis, dessen berühmtestes, gesprüht an Mauerreste des Palastes wohl lautet: „Die DDR hat es nie gegeben.“
Auch die Änderungen der musealen Landschaft erhalten eine dialektische Beschreibung, deren Kernbotschaft sich in der mehrdeutigen Überschrift mitteilt, die DDR gehöre ins Museum. Dabei geht Candidi auf den Spagat aller Ausstellungen ein, ein Bild der DDR zwischen Parteidiktatur und Alltag zu zeichnen, ein Unterfangen, das in aller Regel misslingt, weil den Akteuren ideologisch klar vor Augen steht, was „Parteidiktatur“ bedeutet, und was dann in den Alltagsschilderungen zu erscheinen hat, als wäre sie darin tatsächlich so vorgekommen.
Die Autorin druckt einige diesbezügliche bissige Kommentare von Besuchern besonders des „Deutschen Historischen Museums“, beschreibt den „Checkpoint Charly“ und einige „Unterdrückungsmuseen“, die sich dem Wirken der Staatssicherheit widmen. Candidi schließt sich weitgehend den Urteilen an, die mehr wissenschaftliche Akribie verlangen. In seinem Nachwort findet Stefano Boni dazu deutliche Worte und fordert nicht nur eine Gleichbehandlung der westdeutschen Kultur, sondern eine wirkliche Aufarbeitung der Kolonisierung Ostdeutschlands.
Was die Geschichte des Umgangs mit der DDR betrifft, kann hier auf die erhellende Studie von Carola R. Rudnick von 2011 verwiesen werden, die sachlich berichtet, wie diejenigen, die sich als die Helden der „Friedlichen Revolution“ sehen, die Geschichte der DDR nach ihrem Gusto zurechtstutzen („Die andere Hälfte der Erinnerung“).
Ein eher kurzes Kapitel ist das über die DDR in der Mediengeschichte nach 1990, das wesentlich eine Film-, aber auch eines der Verlags- und Pressegeschichte ist. Dieses bedarf einer besonderen Studie, für die aber Einsicht in die Unterlagen der Treuhandanstalt nötig ist, wo die Akten noch geschlossen sind.
Das letzte Kapitel behandelt, wie oben angedeutet, private Erinnerungen. Hier diskutiert die Autorin, wie aus autobiographischen Erinnerungen, die stets subjektiv sind, ein objektivierbares Gedächtnis gewonnen werden kann. Durch einen Vergleich mit den qualitativen Befunden kann zwar „keine abstrakte Verallgemeinerung einer jeweils persönlichen Wirklichkeit“ erzielt werden. „Dennoch sind die gesammelten Zeitzeugenberichte, die aus einer möglichst repräsentativen Zielgruppe ausgewählt wurden, das unverzichtbare Instrument, um die verschiedenen Gedächtnisräume zu vergleichen und über die individuelle Dimension hinaus Wiederholungen und Unterschiede in der Darstellung der Vergangenheit nachzuvollziehen.“ (S. 296)
In der Folge fragt Candidi nach Kriterien einer ostdeutschen Identität und unterscheidet sieben Generationen, die sich unterschiedlich erinnern. Nach Einführung des Begriffs der „Wiedergewärtigung“, worin kein „Rückkehr-Schmerz“ verstanden werden soll, läuft ihre Untersuchung letztlich darauf hinaus, einen kollektiven Horizont gemeinsamer Erfahrung festzuhalten, „der durch die Umstrukturierungskraft des Gedächtnisses zu einem unverzichtbaren Zugehörigkeitsmerkmal wird“. (S. 335) Daraus leitet die Autorin Phasen der Erinnerungskultur ab.
Abschließend ist auf drei Aspekte zu verweisen. Erstens ist hervorzuheben, dass Liza Candidi sehr einfühlsam mit ihren persönlichen Quellen umgeht, so unterschiedlich deren Sichtweisen auch sein mögen.
Zweitens fällt dem kritischen Blick dann doch auf, dass ein wesentliches Charakteristikum Ostdeutschlands und auch Ostberlins fehlt, deren mehrheitlich religionsferne Feste und Feiern, praktiziert (etwa mit Jugendweihen) an ebenfalls verschwundenen Orten (Kulturhäuser, Klubs usw.).
Der Eindruck, drittens, den Liza Candidi bei ihrer Leserschaft mit den geballt vorgeführten Befunden ihrer Studie vermutlich ungewollt hinterlässt, ist wohl nicht nur bei den Angehörigen der von ihr so genannten „integrierten Generation“, den 1949 bis 1960 Geborenen, deprimierend. Denn die Bündelung der von ihr herausgefilterten Eingriffe in institutionalisierte Gedächtnisräume, dazu noch in historisch kurzer Zeit von nur zwanzig Jahren, verdeutlicht eine massive Entwertung in der DDR gelebten Lebens. Die süßlichen Sonntagsreden führender Regierungspolitiker, die um den dreißigsten Jahrestag der Einheit herum anderes behaupten, sind leere Worte am falschen Orte.
Die Rezension ist auch als zitierfähiges PDF verfügbar.
Immer auf dem Laufenden bleiben? UNSER NEWSLETTER